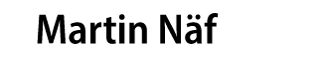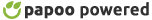Meine Reise nach Mauretanien, Senegal und Gambia - 2012
Mauretanische Impressionen: Vier Wochen in Nouakchott
Anders als bei meinem letzten Aufenthalt in Nouakchott wohnte ich diesmal nicht im Hotel, sondern bei Ousmane und seinem Freund Amadou mitten im eher armen, dicht bevölkerten 6. quartier. Wir hausten einen Monat lang zusammen in einem Zimmer im Haus von Amadous Familie: drei Matratzen an den Wänden um einen Teppich, auf dem zum Essen jeweils ein Tuch ausgebreitet wurde. In einer Ecke auf einem Tablett ein Gaskocher zum Tee machen und zwei oder drei Becher und ein paar andere Utensilien. Gegenüber der Tür zwei schmale Fenster auf eine Gasse, wie alle Seitenstrassen hier weder gepflastert noch geteert, sondern blosser Sand. An unser Zimmer anstossend "la douche", ein Raum mit einfachem Zementfussboden und, etwas erhöht im hintern Teil ein in den Boden eingelassenes Kauerklo - Tschinkeschissi, wie wir vor 50 Jahren in der Schweiz gesagt haben.
Während der vier Wochen in unserer Junggesellenbude erlebte ich sehr viel mauretanischen Alltag: ich lernte Ousmanes und Amadous Freundeskreis kennen; ich trank viel Tee - man trinkt ihn dort aus kleinen Gläsern, die man laut schlürfend in einem Zug leert, nicht gemütlich und langsam aus grossen Gläsern wie in Marokko. Dabei stört das Schlürfen niemanden. Ja es ist geradezu ein Muss! In den Tee zu pusten, um ihn auf diese Weise abzukühlen, ist dagegen äusserst unschicklich. Der Prophet habe im Koran davor gewarnt, sagen die einen. Andere wissen davon nichts. Doch dass man weder auf sein Essen, noch in seinen Tee pustet ist klar! - Andere Länder, andere Sitten!
Andere Sitten herrschen auch beim guten Tag und auf wiedersehen sagen: vom Gutentag-sagen können sie in Mauretanien und im ganzen übrigen Westafrika nicht genug kriegen, das Aufwiedersehen-Sagen wird dagegen weitgehend vergessen oder mit einem kurzen Kopfnicken erledigt. Ich musste mich zunächst wieder daran gewöhnen, dass ich hier jederzeit bereit sein muss, irgend einem Menschen, der eben zu uns hereingekommen ist, in rasendem Tempo und genau berechnetem Rhytmus sieben Mal hintereinander zu versichern, dass es meiner Familie gut gehe, dass es auch meinem Vater gut gehe und meiner Mutter auch, dass bei der Arbeit alles okay sei, ich mich sehr gesund fühle, dass die Reise o.k. war und zuhause alles in Ordnung ist, alles, ja auch die Kinder, und die Familie, und die Mutter, und die Arbeit, und die Gesundheit ... . Wenn man sich nicht dagegen sträubt, ist die Prozedur nicht so schlimm wie es sich anhört. Im Gegenteil. In dieser schwungvollen Art der Begrüssung steckt auch ein energetisierendes Element, man muss es nur erst begriffen haben. Beim Abschied ist's ganz anders. Aufstehen und gehen - das ist alles. Wer Lust hat sagt noch "à demain" oder "?à plus tard", mehr braucht es nicht und auch dieses wenige kann man problemlos beiseite lassen. Andere Länder, andere Sitten.
Ousmane hatte auch diesmal wieder ein dichtes Besuchsprogramm für mich zusammengestellt. Ich ass im Schneidersitz auf der Erde mit vielen menschen viel leckeres Essen. Ich diskutierte mit einer gemütlichen Matrone über die Stellung der Frau in der mauretanischen Familie, übte mit Ismael die neuesten senegalesischen Tanzschritte, hörte mir Jajas abenteuerliche Liebesgeschichten an und bekam mit, wie er sich mit viel Seufzen und Jammern für seine Hochzeit rüstete. "O, Martin! Die Ehe ist ein Gefängnis, aber was willst du! Es muss sein, und ich liebe sie ja ...". An einem Abend gingen wir in ein von Jaja mitorganisiertes Konzert einiger Rapper, eine ziemlich flaue Angelegenheit. Man rappte über irgendwelche CDs, Livemusik gab es nicht. Dabei gibt's auch in Mauretanien sehr spannende Musik - auch Rap!
Ein besonderes Ereignis war ein Ausflug in die Wüste, ein richtiges Pick-Nick mit einem Auto voller Freunde und einer kläglich meckernden Ziege im Kofferraum, die - wie bei solchen Pick-Nicks üblich, vor Ort geschlachtet und gehäutet wurde. Ich habe dabei als Metzgerlehrling assistiert. Nach dem Essen machten wir einen kleinen Spaziergang durch die Dünen und veranstalteten ein paar Ringkämpfe. Danach gab's noch einmal eine Ladung Fleisch und Tee gewürzt mit viel Gelächter und Frotzeleien.
An einem Mittag habe ich Amadous zerbrechlicher Grossmutter die Photos meiner Familie gezeigt, die ich diesmal vorsorglich mitgebracht habe. Sie sass jeden Tag mit krummem Rücken auf ihrer Matte im Flur vor unserer Tür und ass dort Mittag. Vor allem die Schweizer Frauen haben es ihr angetan. Die alte Frau verkauft kleine Schmankerl, die sie bei sich zuhause vorbereitet und auf einem Tablett jeden Tag an die Strasse trägt. Dort sitzt sie 6 odr 8 oder auch 12 Stunden, bis sie alles verkauft hat. Sie verdient damit ein oder zwei Franken, nicht viel, aber besser als nichts. Ousmanes Mutter betreibt ein ähnliches Geschäft. Die beiden sind Kleinstverdienerinnnen. Amadous Mutter scheint mehr Pepp zu haben. Sie hat früher Maiskolben gegrillt und verkauft, doch ist sie schon vor Jahren in den Fischhandel eingestiegen. Jetzt bricht sie jeden Morgen um fünf in Richtung Fischmarkt auf, kauft ein und verkauft im Quartier auf dem markt. Dass bringt mehr - vielleicht drei oder vier Franken. Für Amadous Familie ein Glück, dennn sein Vater, der auf Baustellen Betonverschalungen macht, ist seit einiger Zeit arbeitslos. Ohne seine Frau wäre er und die Familie aufgeschmissen. Die Grossmutter sollte eigentlich auch bei uns wohnen, doch das Zimmer im neuen Haus ist ihr zu teuer; so ist sie denn am alten Ort geblieben. Man hat kein übriges Geld, um ihr das Zimmer billiger zu geben, und sie will nicht zur Bettlerin in der eigenen Familie werden. Seit sie einmal hingefallen ist, fällt ihr das gehen schwer. Sie braucht einen Stock und kann ihr Tablett deshalb nur noch mit grosserMühe zur Strasse tragen. Doch wenn Amadou keine Zeit hat und auch sonst niemand kommt, so tut sie es noch immer, wackelig und krumm, aber sie tut es. Jetzt sitzt sie da und kuckt die schönen Frauen aus der Schweiz an. Sie hat gegessen. Bald wird sie zur Arbeit gehen. Ausser "Famille" und "Suisse" ist kein grosses Gespräch möglich.
Französisch ist neben Arabisch in Mauretanien zwar Nationalsprache, doch es gibt viele, die es kaum oder gar nicht sprechen. Zu den Vielen gehört auch ein etwa 70jähriger Mann, der vor Jahrzehnten vom Lande kommend in Nouakchott eingetroffen sei, zu Fuss und völlig verloren. Er sei seinen Herrschaften davongelaufen; er kenne weder seine Eltern, noch wisse er, wann und wo er geboren wurde erzählen mir Ousmane und Amadou, die jedes mal, wenn uns der Mann in ihrer Gasse begegnet, ein Schwätzchen mit ihm abhalten. Der Mann lacht und schüttelt auch mir die Hand. Seid er in Nouakchott ist, hält er sich als Latrinenreiniger über Wasser. Ein Eimer und eine Schaufel sind seine Werkzeuge. Wenn die Geschäfte einmal nicht so gut gehen, helfen ihm die Menschen im Quartier mit ein paar Uguyas oder einem Teller Essen aus. Der Mann erinnert mich daran, dass es in Mauretanien trotz offiziellen gesetzlichen Verbots noch immer rund 600.000 Sklaven geben soll. Im Alltag merke ich nichts davon; auch in den Gesprächen taucht das Thema nicht auf ...
Ousmanes Gemüseanbauprojekt
Im Mittelpunkt meines Besuches in Mauretanien stand - zumindest in den ersten Wochen - das Gemüseanbauprojekt, für welches Ousmane sich seit unserer Begegnung im Dezember 2010 einsetzt. Die Projektidee stammt ursprünglich von einem Onkel Ousmanes, der lang in einer hohen Stellung bei der mauretanischen Nationalbank gearbeitet hat: Er hatte in den 1980erjaren auf einer seiner Reisen irgendwo in Afrika eine Gemüseanbaugenossenschaft von behinderten und nicht behinderten Menschen gesehen. So etwas wollte er jetzt ebenfalls tun. Er erzählte Ousmane und mir von dem Plan, als wir ihn anlässlich meines ersten Aufenthalts in Nouakchott besuchten, um über ein paar Projektideen zu sprechen, die uns damals beschäftigten. Ich war von der Idee nicht besonders angetan, doch hatte ich mich bereit erklärt, mir einen allfälligen Projektbeschrieb anzusehen und danach zu entscheiden, ob und wie ich mich an der Sache beteiligen würde. Dieses unverbindliche Interesse war in den Köpfen der Beteiligten im Laufe der Zeit jedoch offensichtlich zu so etwas wie einem festen Hilfsversprechen geworden. In Erwartung dieser Hilfe hatte der Onkel Ousmane im letzten Sommer zum Projektleiter gemacht, obschon Ousmane herzlich wenig von Gemüseanbau versteht und sich im Grunde auch nicht dafür interessiert.
Im Verlauf des Herbstes hatten wir mehrmals über das Projekt gesprochen; es waren nervige Telefonate, denn die Verbindungen waren schlecht und Ousmane war offenbar nicht fähig oder willens, auf die Fragen einzugehen, die ich nach Erhalt einer langen, viel zu komplizierten Projektbeschreibung per Mail gestellt hatte. Ousmane fragte nur immer wieder, was denn nun mit der versprochenen Hilfe sei. Schliesslich sagte ich ihm, ich wolle mir die Sache an Ort und Stelle ansehen und dann über meine mögliche Mitarbeit entscheiden.
Im Laufe meines Besuches bestätigten sich meine Zweifel: Das Projekt ist zu kompliziert. Es gibt zu viele offene Fragen, und zu wenig Antworten. Die Mitglieder des Projektteams sind zuversichtlich. Was mir planlos und chaotisch erscheint ist für sie normal, aber ich kann und will mich nicht aus lauter Freundschaft oder aus falschem Mitleid auf eine Sache einlassen, die mich nicht überzeugt. Ousmane hat viele Talente, und er hat einige gute Leute für sein Projektteam gewinnen können, doch ist er mit seiner Aufgabe im Grunde überfordert. Er stimmt mir halb und halb zu, doch hat er das Gefühl, die Sache jetzt durchziehen zu müssen. Er tut mir Leid, doch ich sehe keine Möglichkeit zu helfen.
Es ist Ousmane und seinen Freunden nicht leicht gefallen, meinen Entscheid zu akzeptieren, obwohl sie in ihrem Projektteam Menschen haben, die das, was ich tun sollte (anträge shreiben und Kontakte herstellen) genauso gut können wie ich. Zum Teil glauben sie dies nicht, weil sie zulange daran gewöhnt wurden, uns Europäern alles, sich selber aber nichts zuzutrauen. Zum Teil haben sie sich im Laufe der Zeit schlicht daran gewöhnt, dass wir Europäer ihre Probleme lösen. Ousmane ist im Grunde ratlos, wie es mit ihm weitergehen soll, doch ist er zu stolz und zu ungeduldig, um sich auf ein wirkliches Gespräch über seine Situation einzulassen.
Drei Neffen von Ousmane hatten mehr Glück mit ihrem Appell an meine Hilfsbereitschaft. Sie baten mich um ein Darlehen zum Kauf von acht Hühnern und zum Bau eines kleinen Stalles; sie wollen damit zur Verbesserung des Budgets ihrer Familien beitragen. Erfolgreicher war auch Amadou, der mich um ein Darlehen zum Kauf eines Taxis bat. In beiden Fällen habe ich zugesagt, nachdem wir die Vorhaben genau besprochen und durchgerechnet haben. Von den Jugendlichen habe ich seither nicht mehr gehört; da herrscht also das Prinzip Hoffnung. Amadou hat kürzlich geschrieben bzw. schreiben lassen, denn selber schreiben kann er nicht: das Geschäft laufe gut, und er sei dabei, den Kredit wie vereinbart abzubezahlen.
Die Zeit in Nouakchott war gut und das Leben mit den Freunden von Ousmane und Amadou hat Spass gemacht. Doch Mauretanien selbst wirkt auf mich nicht wie ein glückliches Land. Neben dem allgegenwärtigen Thema der Armut, der Korruption und ähnlich unerfreulichen Dingen schwebt über dem Land eine Wolke religiös verbrämter politischer Repression, die alles irgendwie zu lähmen scheint. Mauretanien ist eine islamische Republik, die von den "weissen Mauren" regiert wird, und in der das blosse Interesse an einer anderen Religion bereits als Verbrechen ausgelegt werden kann. Es herrscht Ruhe in dem Land, doch es ist keine zufriedene ruhe.
Amadous Paradies oder: Die Reise nach Gambia
Anfang März brachen Ousmane, Amadou und ich nach Gambia auf. Die beiden hatten meine Einladung, mich auf der Reise zu begleiten, freudig angenommen. Ousmane wollte die Gelegenheit benützen, unterwegs ein paar Verwandte und einige soziale Einrichtungen zu besuchen, die auch mich interessieren würden, und Amadou wollte Gambia sehen! "Gambie! Je vais voir la Gambie! Pour moi c'est presque comme voir le paradis." Wir verbrachten drei interessante, aber auch mühsame Tage bei Eisata, der engagierten Leiterin der "Antenne Sociale" in Bogue (Mauretanien) und einen sehr friedlichen Tag bei einem Onkel von Ousmane in einem kleinen Dorf am Senegal Fluss, von wo wir mit Kanu, Pferdewagen und Fähre illegal aber höchst romantisch in den nach dem Fluss benannten Senegal übersetzten. Dort besuchten wir einen Freinet-Lehrer in St. Louis, das Institut des Jeunes Aveugles du Sénégal in Thiès und eine von einer Basler Bekannten seit Jahren unterstützte Schule in Malikunda bei Mbur (ebenfalls im Senegal). Die 10 oder 12 Tage on the road waren wieder voller Gespräche und Begegnungen aller Art. Sehr angenehm im Fall von Ousmanes Onkel in dem kleinen Dorf: ruhig, überlegt, klug. Gut auch im Senegalesischen Blindeninstitut, wo ich u.a. mit ein paar sehr temperamentvollen und wachen Jugendlichen über ihr Leben als blinde Gymnasiasten in einem gewöhnlichen Gymnasium und ihre Berufsperspektiven Sprach. Der Aufenthalt in Malikunda war erholsam. St. Louis und Bogue dagegen waren sehr anstrengend: Zu viel Gerede, zu viel Allgemeinplätze und grosse Worte. Ich war entsprechend froh, als wir - nach einem weiteren Tag im Sept-Place-Taxi und einer einstündigen Fahrt über die Mündung des grossen Gambia River - am 15. März schliesslich in Banjul, der Hauptstadt Gambia's ankamen und 30 Minuten später in Senekunda von Alieu und seiner Familie - seiner Frau, seiner Mutter, zwei Kinder und zwei unverheirateten Onkeln - in empfang genommen wurden.
Alieu und die gesellschaftliche Integration behinderter Menschen in Gambia
Alieu ist Mitte oder Ende 20. Er hatte mich einige Monate zuvor angeschrieben, um mit mir über sein Projekt zur Förderung blinder Studierender in Gambia zu diskutieren. "Wir Blinde", so erzählt er mir, "können eigentlich nur Lehrer an der Blindenschule werden. Nur ganz wenige von uns haben bisher ein anderes Fach studiert. Es ist ein Problem der fehlenden Infrastruktur und vor allem der Mentalität. Gambia ist einfach noch nicht dort. Aber es bewegt sich inzwischen einiges, nicht zuletzt auch wegen der Carta der Rechte der Behinderten und ähnlichen internationalen Dokumenten."
Ich bleibe acht Tage bei Alieu; er und seine junge Frau sind ausgesprochen nett und das Leben mit Alieus Mutter und seinen beiden unverheirateten Onkeln ist sehr angenehm. Nach drei Tagen reist Amadou ab. Seine Erwartungen sind aufgegangen. Er schwärmt vor allem von der Hellen Strassenbeleuchtung und den schönen Geschäften von Banjul. O ja, beinahe wie im Paradies;viel schöner als in Nouakchott! Zwei Tage später geht Ousmane. Er will die zweite Runde der Wahlen im Senegal bei Verwandten in Dakar miterleben. Er freut sich wie auf ein Fussballspiel.
Alieu zeigt mir an zweiten oder dritten Tag meines Besuches die Geschäftsstelle des nationalen Behindertenverbandes und der "Gambian Organisation of the Visually impaired" (GOVI), sowie die am selben Ort untergebrachte Blindenschule, an der er arbeitet. Es gibt viel zu sehen und zu reden. Besonders beeindruckt bin ich von einem grosszügigen Schulungsraum mit vier von einer irischen Entwicklungshilfsorganisation gesponserten Computerarbeitsplätzen für Blinde. Die mit der neuesten Bildschirmlese- und Texterkennungssoftware bestückten PCs, die grossen Arbeitstische und Stühle, der mit den PCs vernetzte Scanner und der schicke Brailledrucker, die Bildschirme und Tastaturen und das ganze übrige Material ist brandneu, vor ein paar Wochen eben erst geliefert und installiert. Ich bin begeistert: Der Raum wäre das ideale Supportzentrum für die blinden Studierenden, für die Alieu sich engagiert. Es gibt Platz, Strom und Internet und sogar einen IT-Fachmann, der für die Ausrüstung verantwortlich ist. Alieu stimmt mir zu. Der Raum wäre ideal, aber die Sachen wurden für ein anderes Programm beantragt, und der Direktor dieses Programms will offenbar nicht, dass fremde Schafe auf seiner Weide weiden! Hier sollen Gambische Primarlehrer in einem Weiterbildungskurs lernen, wie blinde Menschen mit Computern arbeiten können. Ich bin beeindruckt, dass die gambische Regierung solche Programme auflegt, allerdings: braucht man für dieses Programm wirklich eine Ausrüstung die alles in allem sicher beinahe eine halbe Mio. Dollar gekostet hat? Würde es da nicht genügen, wenn Alieu oder ein anderer Blinder mit seinem Laptop käme, und den LehrerInnen zeigt, wie er im Internet surft oder eine E-Mail schreibt? Wenn es um die Ausbildung von HeilpädagogInnen und ambulanten Fachlehrern ginge, dann ist eine detaillierte Einführung in das Thema vielleicht sinnvoll - aber Primarlehrer aus dem Gambischen Hinterland? In ihren Schulen gibt es in der Regel weder Strom noch Internet; es fehlt an Kreide, Bänken und Büchern und zuhause fehlt es an Essen und Medikamenten ...
Alieu sagt, dieses Ausbildungsmodul sei tatsächlich etwas praxisfern, doch es sei nun einmal so beschlossen. Ich überlege, was ich PrimarlehrerInnen in dieser Situation erzählen und zeigen würde. Ich erinnere mich an die einfachen Hilfsmittel, mit denen ich als Primarschüler im Basler Sevögeli in den 1960erjahren gearbeitet habe. Ich frage Aliieu, ob er die Plastikrechentafel mit den Zahlenwürfeln oder die billigen Zeichenfolien kennt, mit denen man auf einfachste Weise Reliefzeichnungen machen kann. Er schüttelt den Kopf, ist jedoch ganz einverstanden: Genau solche Dinge sollten die LehrerInnen kennenlernen, Dinge, die man für 10 oder 20 Dollar bekommen und jedem Kind zur Verfügung stellen kann. Dazu ein paar konkrete Tips für den Umgang mit einem blinden oder sehbehinderten Kind.
Auch jetzt stimmt Alieu mir zu, doch anders als ich regt er sich über die verquere Situation nicht auf. Dazu ist er zu sanftmütig und vielleicht auch zu abhängig vom Wohlwollen derer, die hier das Sagen haben. Sein Sanftmut beeindruckt mich, doch er macht mich auch nervös: Hier gibt es alles, um ein leistungsfähiges Supportzentrum für blinde Studierende einzurichten und zu betreiben, und Alieu, dem genau das vorschwebt, nickt nur still und gibt sich mit einem 12 Quadratmeter grossen Kämmerchen und ein paar alten PCs zufrieden, die seine Schule oder der Gambische Blindenverband ihm überlassen haben, und die er in diesen Wochen entwurmen und in Betrieb nehmen will. Der Leiter des Primarlehrer-Fortbildungsprogramms, der über das moderne Computerlab herrscht, ist leider nicht zu sprechen. Ich hätte gerne noch mehr davon gehört, was er mit den LehrerInnen während der zwei Wochen tun wird, und ob es wirklich nicht möglich ist, seinen Raum auch für andere Zwecke zu nutzen.
Bei Alieu zuhause - auf der Matte unterm Mangobaum - sitzen wir noch lange und diskutieren über die verschiedenen, von der Gambischen Regierung und Privaten Organisationen geplanten Programme zur Förderung der schulischen und beruflichen Integration behinderter menschen in dem kleinen extrem armen Land. Zum ersten Mal seit ich in Afrika bin habe ich das Gefühl, von dem, wovon wir sprechen, wirklich etwas zu verstehen - nicht nur im Grossen Ganzen, sondern bis hinein ins Detail! Und zum ersten Mal denke ich daran, mich von einer grösseren Organisation oder einem Ministerium als Berater engagieren zu lassen. Alieu stimmt mir zu: ich könnte genau die Art von konkreter und praxisnaher Beratung bieten, die sie im Augenblick brauchen, denn sie hätten zur Zeit noch keine eigenen ExpertInnen in dem Bereich.
Die Perspektive belebt mich; sonst aber bin ich meist sehr müde. Ich merke, dass ich von den ewigen Gesprächen darüber, was man tun könnte und müsste, allmählich genug habe. Ich möchte handeln, möchte anpacken, möchte wieder - wie im vergangenen Jahr an der Université Panafricaine de la Paix - mitten drin stecken in einer spannenden und guten Arbeit. Stattdessen bewege ich mich seit Wochen in einer Welt, in der sich kaum etwas bewegt. Sicher, ich habe viele sympathische Menschen getroffen, hatte auch einige gute Gespräche, und ich habe an einigen Orten meine E-Mail-Adresse hinterlassen, doch mit Ausnahme von Alieu hatte ich nicht den Eindruck, dass irgendwo ein tatsächliches Interesse daran besteht, den Kontakt weiterzuführen. Während ich über meine schlechte Laune nachgrüble merke ich, wie viel ich von den menschen hier erwartet habe. Ich beginne innerlich zu lachen. Natürlich wäre es schön, andauernd auf initiative und mutige Menschen zu stossen,die eben ein spannendes Projekt begonnen haben, in das ich voll einsteigen kann ... Doch wie oft kommt so etwas vor? Und weshalb soll es in Afrika öfter vorkommen als in der Schweiz? Weshalb hadere ich mit der Passivität und Halbherzigkeit der meisten Menschen, denen ich hier begegne? Sind wir in Europa nicht genauso? Ziehen die meisten Menschen es nicht auch bei uns vor, über ihre Situation zu jammern statt sie zu verändern? Warum sollen die menschen in Afrika anders sein als in Europa? Ich bin müde und auch etwas traurig, doch das Nachdenken hilft ein wenig. Wie leicht schlägt unser wohlgemeinter Helferwille doch in latenten Groll und Ärger um, sodass wir dort, wo wir helfen wollen, bloss schlechte Laune und Stress verbreiten. Ich denke mit Schrecken daran, wie viele wohlmeinende LehrerInnen und Missionare auf diese Weise nach und nach zu unausstehlichen Tyrannen und humorlossen Moralklössen geworden sind! Ich denke daran und versuche mich zu entspannen ...
Zu meinem Helferblues hat sich in Gambia noch ein hartnäckiger Reisekoller gesellt.Ich denke die ganzen Tage darüber nach, , wie ich von hier in den Niger kommen würde: Per Schiff oder Pirogue den Gambia River hinauf und irgendwann per Buschtaxi weiter in Richtung Bamako oder per Bus von Banjul direkt nach Bamako oder zuerst irgendwie südwärts in Richtung Guinea oder ... Die Sache ist zermürbend, denn es fehlt mir an Informationen und Mut, und alles,, was das Internet auf die Schnelle zu dem Thema hergibt, sind die grimmigen Reisewarnungen der europäischen Aussendepartemente, gegen die sich mein inneres immer mehr empört, die mich aber doch unsicher machen. Schliesslich hat mich die grosse Politik von dieser mentalen Achterbahnfahrt erlöst, denn Nach dem Putsch in Mali vom 22. März und der folgenden Schliessung der Grenzen, war klar, dass alle Überlandrouten in den Niger sehr umständlich wären. Falls ich überhaupt gehen würde, würde ich fliegen.
Martin Näf, copy 2012