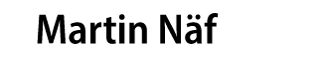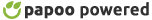Japan und USA! - Winter 2005-06
Nach weiteren 6 oder 7 Flugstunden bin ich in Japan. Kurz nach 18:00 liegt das Einreiseprozedere hinter mir. Die zierliche Japanerin, die mich betreut, berät mich jetzt, wie ich am besten nach Sendai komme. Tsos Vorschlag erscheint ihr als eher unpraktisch.Sie erkundigt sich nach Bahnverbindungen und verhilft mir schliesslich zu einem Ticket nach Sendai. Ich staune über die Freundlichkeit und die Effizienz der Hilfe. Einmal wird sie von einer Kollegin abgelöst. Offenbar ist ihre Schicht vorüber oder sie hat etwas anderes zu tun. Doch die Kollegin ist genau so nett und effizient. Beide sprechen relativ gut englisch. Sie erklären, dass ich bis Tokio Main Station sitzen bleiben soll. „Second stop, about one hour". Dort würde ich von einem Eisenbahnangestellten abgeholt und auf den Zug nach Sendai gebracht. So geschah es denn auch. Der Transfär ging mit viel „hai hai hai. Hai, hai" in unterschiedlicher Akzentuierung und Lautstärke über die Bühne. Englisch sprach der Helfer in Tokio nicht, aber nett war auch er. Kurz nach 20:00 sass ich im Zug nach Sendai. Um 22:40 war ich dort und kurz darauf tauchte auch Tso auf. Tso, der gute Mensch von Gualulumpur, stucking in Japan. Nach einer weiteren Stunde sind wir in Ogawara, einem Vorort von Sendai, wo Tso und Miwako seit einem halben Jahr leben.
Die Landschaft rund um Ogawara erinnert mich anfänglich stark an die Hügel und Wälder rund um Basel. Der Eindruck wird durch das kalte und trockene Wetter und die gelegentlichen Spuren von Schnee und Eis verstärkt. In Ogawara wohnt Miwakos Familie, wo Tso als frisch bebackener Vater und Ehemann seit einem halben Jahr festsitzt. Zur Familie gehören neben ihm und seiner Frau Miwako die 91-jährige Grossmutter, Vater und Mutter Sato und Sasa, das 4 Monate alte Baby. Tso war froh über meinen Besuch, und ich genoss die vier Tage in vollen Zügen. Wir haben viel geredet und geraucht. Die Zigarettenmarke hiess pikanterweise "Hope". Unser Thema war ebenfalls oft "Hope" oder lack there off.
Tso hofft sehr auf Malaisia und Theiland, wo er sich mit Miwako und Sasa niederlassen will, sobald Miwako genug Geldverdient hat und das Baby alt genug für einen längeren Flug ist. Hier in Japan fühlt er sich sehr unwohl. Er versteht die Sprache nicht und weiss oft nicht, was von ihm als Hausgast und Schwiegersohn erwartet wird. Sein chinesisches Erbe rebelliert gegen die Ignoranz, mit der die Mehrheit der Japaner, auch seine Schwiegereltern, die japanische Okkupation Ostasiens vor und während des zweiten Weltkriegs behandeln. Auch mit Miwako gibt es immer wieder Streit. Oft sind es sprachliche Missverständnisse.
Tso und ich reden über seine momentane Situation, seine künstlerischen Wünsche, seine Vergangenheit in Gualulumpur, über meine und seine Sexualität. Zwischendurch fahren wir ans Meer, besichtigen irgendwelche verlassenen Shintuschreine, machen kurze Spaziergänge in den Wäldern der Umgebung und auch ein richtiges japanisches Erdbeben gibt es, wobei ich flach auf dem Bauch auf meinem Futon liege und fasziniert auf das Klappern und Kleppern der vielen Schiebetüren des Hauses Sato horche, während Tso sich mit einem Satz im Kleiderschrank in Sicherheit bringt ...
Es sind vier reiche und gute Tage. Im Rü'ckblick wirkt das Ganze wie eine Postkarte: Im Hintergrund die verschneiten Hügel Japans und im Vordergrund Tso, lang und dünn, Spiderman, wie er sich selbst nennt. Aufgewachsen in einer armselingen Hütte in den Slums von Gualulumpur, sein Vater krank als er sechs war. Seine Mutter, die ihn und seinen Bruder durchzubringen versucht. Tso, der nach dem Tod seines Vaters Angst hat, alleine in der Hütte zu schlafen. Tso, der nach der Schule auf der Müllhalde hinter dem Schweinestall nach Verkaufbarem sucht. Tso, der als Jugendlicher hoch über der Erde Wassertanks montiert, immer in Gefahr abzustürtzen, immer in der Hoffnung, voranzukommen. Tso, der die Kunstakademie in Gualulumpur besucht. Tso, der anders ist als seine Mitschüler ... Spiderman und friend.
USA zum ersten
Am 19. Dezember, einem Sonntag, kam ich gegen neun Uhr vormittags in San Franzisco an. Ich blieb bis zum 18. März 2006 in den USA, wobei ich den grössten Teil der Zeit lesend, recherchierend und schreibend bei Amie in Davis, CA, verbracht habe.
Vom 2. bis zum 7. Februar war ich bei Cathrin in San Diego. Auf dem Rückweg nach Davis verbrachte ich zwei Nächte und einen Tag bei Dan Kish in Long Beach. Zwei oder drei Wochenenden war ich in San Franzisco und der "Bay Area", wo ich Jerry Diller, Barb und CG und Garry Bender besucht und einige Zeit mit Kevin Madden, einem Freund Amie's verbracht habe.
Mit Barb, die mir seit unserer guten Zeit in Eugene zunehmend fremd geworden war, habe ich mich endlich einmal ausgesprochen. Ursprünglich wollte ich nicht bei ihr vorbei, doch dann entschied ich mich anders. Sie scheint weniger abgehoben als vor fünf oder zehn Jahren; die Beziehung mit C.G. ist noch immer prekär, doch Barb weiss nicht, was sie ohne ihn täte. Gerry Diller wirkt etwas erschreckt und verwirrt. Er spricht gerne von der traumatischen Erfahrung seiner jüdischen Existenz. Es ist beinahe als ob er hierin einen Grund gefunden hat, von anderen ernst genommen zu werden. Der Nachmittag und die Nacht mit Garry Bender waren sehr seltsam. Er zeigte mir einige urzeitliche Pflanzen im Golden Gate Park, kochte ein hervorragendes Abendessen für mich, wir rauchten Dope und tranken einen guten Wein, doch sonst geschah nichts. Kein Gespräch, kein Sex, keine erotischen Freuden. Er redete andauernd, brauchte mich nicht einmal als Stichwortgeber. Er war extrem freundlich, sagte auch, er freue sich über unser Wiedersehen, doch er wirkte in allem so unnahbar automatenhaft, dass ich eigentlich nichts von ihm weiss und ihn keinen Moment wirklich gespürt habe. Keven Madden, ein interessanter Typ und ein wirklicher „Gewinn" in meiner Sammlung von Freunden, meinte, es sei vielleicht eine Art Aidsfobie, eine zur zweiten Natur gewordene Zurückhaltung, mit welcher ich es zu tun gehabt habe. Ich weiss es nicht. Habe Garry auch gar nicht nach Aids und damit verbundenen Ängsten gefragt. Er selbst scheint gesund, scheint auch keine Medikamente zu nehmen, aber vielleicht liegt in dieser Richtung tatsächlich eine Erklärung für sein seltsames Verhalten.
Am 22. Februar fuhren Amie und ich nach Eugene. Wir verbrachten zwei Nächte bei Joy Poust, der ehemaligen Sekretärin des Honors College; ich machte einen ausgedehnten Spaziergang durch den Campus der U of O, wobei mir alles verändert und fremd vor kam. Wir begannen mit einer Serie von drei Interviews mit Lois, die wir am 26. Februar in Portland abschlossen. Dort besuchte Amie ihren Bruder Keven mit Frau Marny und ihrem kleinen Jungen Franky, während ich bei Peter (Decius) wohnte und Keven und Familie lediglich am Samstag und Sonntag relativ kurz sah.
Die Erinnerung an die Tage mit Peter bedrückt mich noch heute. Es geht ihm extrem schlecht. Er schläft miserabel, hat einen lausigen 20 oder 30%Job als Putzmann während drei oder vier Abenden pro Woche in einer örtlichen Bibliothek, bekommt dazu etwas Sozialhilfe und schleppt sich durch eine Umschulung zum Computerspezialisten, die ihm vom Arbeitsamt bezahlt wird. Dank teurer Medis (wenn ich mich richtig erinnere sprach er von $3000 pro Monat!) und regelmässigen Besuchen beim Psychiater scheint seine manisch-depressive Veranlagung seit einiger Zeit unter Kontrolle; er ist vor allem müde und mutlos, tut aber brav, was er muss. Es ist eine Chance, die ihm das System gegeben hat. Danach kommt vermutlich nur noch die Strasse. Ausser mit seinen beiden Schwestern hat er kaum noch regelmässige Aussenkontakte.
Am 28. Februar flog ich von Portland nach New York. Nach 8 oder 9 interessanten, aber auch ziemlich strapaziösen Tagen bei Kathy ging's weiter zu Bill und Marianne und von dort am 12. März schliesslich zur letztn Station der Reise, zu Ken Kronenberg und Eve Golden in Cambridge, Massachussets. Am Vormittag des 19. März 2006 war ich wieder in Basel, wo ich seither mit der Neueinrichtung meines Lebens beshäftigt bin.
USA zum zweiten
Alle extravaganten Dinge, die ich mir ursprünglich für die USA vorgenommen habe, habe ich fallen lassen: Ich war weder in Steven Harrisons „Living School" in Boulder, Colorado, noch in Chris Griscoms „Mizhoni School" in Galisteo, New Mexiko, noch in einer der anderen „alternativen" Schulen, die ich mir hier ansehen wollte. Bis jetzt habe ich auch keinen Kontakt mit John Taylor Gatto, Jonathan Kozol oder einem der anderen Schulkritiker aufgenommen, die ich eigentlich besuchen wollte und über die ihr im Bedarfsfall via Google mehr erfahren könnt. Ich habe gemerkt, dass mir das, was ich hier im Gespräch mit meinen Freunden und deren Bekannten und im Rahmen meiner schriftstellerischen Schreib- und Grübelarbeit erlebe vollauf ausreicht. Mein Kopf und mein Herz sind voll, und obschon es Schade ist, diese Gelegenheiten alle auszulassen, ist mir mehr nach Verdauen als nach weiteren Fragen und Diskussionen zu Mute!
Ich bin wieder einmal daran, meine kritischen Gedanken zum Thema „Schule" und meine eigenen Vorstellungen von einer lebendigen Bildungslandschaft zu Papier zu bringen oder besser auf die Festplatte zu bannen. Schreiben ist für mich allerdings immer eine turbulente Angelegenheit, und so trieb ich auch diesmal bald wie ein Schiffbrüchiger auf einer stürmischen See von aufwühlenden Gedanken und Themen, deren auf und ab und hin und her mich zwischendurch scheinbar weit ab von meinem eigentlichen Projekt gebracht haben. Statt meinem ursprünglichen Konzept zu folgen und in systematischer Weise über die Entstehung des modernen Bildungswesens, über die ihm gegenüber von Anfang an bis heute geäusserte Kritik, seine aktuellen Probleme und über konkrete Möglichkeiten ihrer Lösung zu schreiben, wurde ich immer mehr zum Spielball des „kreativen Prozesses", wie man so etwas wohl nennt. So wie Kolumbus, der nach Indien segeln wollte und dabei Amerika entdeckte, bin ich auf meiner Reise auf ein gewirr mir ganz unbekannter Inseln und Halbinseln gestossen, die scheinbar nichts mit dem zu tun haben, worum es mir ursprünglich ging. Statt über die Schule und die in ihr praktizierte Erziehung zur Bravheit und über Alternativen zu diesem fatalen Modell zu schreiben, schrieb ich über die Furcht des Menschen vor seiner eigenen Freiheit und über die Logik des Kapitalismus, in dem alles – unsere sozialen Beziehungen, die Erde mit all ihren Gütern, unser Lachen und Weinen, unsere Ängste und Freuden, unsere Abenteuerlust, unsere Einsamkeit, unsere Neugier und unsere Gesundheit, unser Lernen- und Begreifenwollen – zu einem Geschäft gemacht, d.h. in Güter und Serviceleistungen verwandelt, zertifiziert und verrmarktet werden.
Ich stöbere im Internet und in der elektronischen Bibliothek, die sich an Bord meines Laptops befindet, nach Literatur, die mir diesen Rätselhaften Vorgang der Selbstzerstörung erklären hilft. Der Mensch – ein Opfer seiner selbst. Das „bessere Leben" als tödlicher Feind des „guten Lebens"? Ich lese ein wenig in Erich Fromms „Sane Society", in Adam Schaffs „Entfremdung als soziales Phänomen" und in ähnlichen Texten; ich stöbere in Wikipedia, der „freien (Online)-Enzyklopädie" und surfe durch allerlei anarchistische und marxistische Seiten, um endlich zu begreifen, weshalb wir Menschen bei all unserer Vernunft und unserem guten Willen insgesamt so dumm und unvernünftig sind. Ich bedaure, nicht mehr solides Wissen über ökonomische und politische Theorien und Zusammenhänge zu haben. Die Welt gerät immer mehr ins Trudeln, ohne dass wir begreifen, was eigentlich los ist. In unserer Hilflosigkeit beschränken wir uns auf irgendwelche Teilreformen und –reförmchen oder ziehen uns ganz in unser Privatleben zurück, drehen die Stereoanlage auf und warten, bis das Schiff untergeht.
Meine Stimmung an Amies Küchentisch ist grimmig. Auf einem meiner Suchläufe durch das Internet stosse ich plötzlich auf das Problem des zunehmenden Medikamentenkonsums in unseren Schulen: Sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene scheinen ihren Arbeitsalltag immer öfter nur noch mit Hilfe von Drogen aller Art überstehen zu können. IN den USA gibt es Schulen in denen rund 30% der SchülerInnen regelmässig Ritalin oder ein anderes Psychofarmaka einnehmen, wobei die Zahlen sich seit Mitte der 1990er Jahre nicht nur hier, sondern auch in den meisten europäischen Ländern vervielfacht haben. Novartis, die Herstellerin von Ritalin, gibt mittlerweile gemäss einem WoZ-Artikel vom Oktober 2005 keine Verkaufszahlen mehr bekannt; man will sich das Geschäft offenbar nicht durch einen Skandal verregnen lassen. Die Einnahme der Medis scheint in einigen Fällen berechtigt und vernünftig, in der Merhzahl aller Fälle geht es schlicht darum, Menschen ruhig zu stellen, die sonst stören würden; zu dem Zweck werden immer neue psychiatrische Begriffe und angebliche Krankheitsbilder erfunden; was früher ein Eigenbrödler war ist jetzt ein Mensch mit „communication disorder" und die Zappelphilippe vergangener Zeiten sind zu Kindern mit „Attention Deficit Disorder" geworden und müssen entsprechend behandelt werden. Die Maschine fordert ihren Tribut!
In Indien kann man eine halbe Stunde später zur Arbeit kommen, ohne dass der Chef Kopf steht, man kann zwischendurch eine Tasse Tee trinken oder für zehn Minuten im Laden eines Freundes untertauchen und mit ihm ein Schwätzchen halten ... Der Westtourist ist vielleicht etwas befremdet über die scheinbare Ineffizienz mit der Geschäfte abgewickelt werden und er ärgert sich darüber, dass man ihn scheinbar grundlos fünf oder gar zehn Minuten warten lässt. Er ist stolz darauf, dass so was in seinem Land nicht vorkommen würde ... dafür steigt sein Blutdruck schon beim blossen Gedanken an die Schule oder an sein Büro. Ein Inder, der schon lange in den USA lebt, sagt mir Anfang März in New York: „Wenn Menschen aus Indien in die USA kommen, dann sind sie zuerst fasziniert und begeistert. Es ist, wie wenn ihre Träume plötzlich in Erfüllung gehen. Aber nach 6 oder 8 Monaten merken sie es. Sie werden nervös, sie fühlen sich unwohl. Es ist, wie wenn sie immer ein wenig zittern ... Es ist die Anspannung. Der Stress."
Die Sache mit den Medikamenten ist in den USA in den letzten Jahren so schlimm geworden, dass die Regierung in Washington im vergangenen Juli ein Gesetz erlassen hat, das SchuladministratorInnen und LehrerInnen verbietet, Eltern dazu zu zwingen, ihren Kindern Ritalin und ähnliche Drogen verschreiben zu lassen. Ich weiss nicht, wieviel Psychofarmaka die Menschen in Indien schlucken und wie es dort mit der Selbstmordrate bestellt ist -, doch was uns angeht, so sind die Zahlen beunruhigend!
Im Zug von Sanfranzisco nach San Jose sitze ich neben einem Computerspezialisten aus Santo Domingo. Er erzählt mir von der dortigen Armut: Diese sei nach wie vor gross. Aber er habe das Gefühl, dass es den menschen in der dominikanischen Republik im Grunde dennoch eher besser gehe als den Menschen in den USA. Auf meine Frage, weshalb er das glaube, sagt er, „sie lachen viel mehr. Sie haben Humor. Sie können total pleite sein und ein wirkliches Problem haben, aber sie verlieren den Humor nicht. So etwas wie Selbstmord gibt es dort einfach nicht". Das klingt schön. Es erinnert mich daran, dass ich mich vor allem während der ersten Wochen in den USA oft nach Indien zurückgesehnt habe, weil dort alles irgendwie fröhlicher und entspannter scheint. Doch für's Geschäft ist diese naive Zufriedenheit natürlich schlecht.
Ich möchte nicht wissen, wie tief der Absatz von Ritalin in Santo Domingo ist! Hoffentlich haben sie wenigstens Fernsehen, damit sie allmählich begreifen, dass sie gar nicht zufrieden sind. ...
Vom Medikamentenkonsum geht meine Reise weiter zum Thema der Werbung, durch welche uns nicht nur Güter, sondern auch Lebensstile und Schönheit, Kraft und tausend andere Ideale aufgeschwatzt und untergejubelt werden. Das Thema ist unangenehm. Ich komme mir vor wie ein Kriegsberichterstatter. Tatsächlich sprechen wir ja ganz selbstverständlich von „Werbefeldzügen" und „Marketing-Strategien", von Märkten, die „erobert" werden sollen oder „verteidigt" werden müssen. Der kriegerische Wortschatz ist kein Zufall. Amie berichtet mir an einem Abend, dass sie kürzlich an einem Seminar eines ehemaligen Kampfpiloten der US Air Force mit dem Titel „Business is war" teilgenommen hat. Im Internet finde ich ein paar Wochen später eine ganze Reihe von Web-Seiten, auf denen über die Verbindung zwischen Business und Krieg philosophiert wird. Dabei kommt auch der berühmte preussische General Carl von Clausewitz zu neuen Ehren. In der Geschäftswelt scheint man über diese Verbindung nicht erschreckt. Warum auch, die Sache ist ja offensichtlich. "Business is war. Arm yourself."
Auf der dauernden Suche nach neuen Möglichkeiten der Expansion gehören Kinder und Jugendliche heute zu den interessantesten Zielgruppen. Ich stosse auf immer mehr Material zum Thema Werbung in der Schule, Kinder und Kommerz ... Ich denke daran, wie unsere LehrerInnen für ihre Fächer „werben", und wie wir den Kindern in der Schule beibringen, auf diese Werbeaktionen und die damit verbundenen Versprechen zu hören: „Mach mit; es ist wichtig für Dich! Nur wenn du dies weißt und auch noch jenes lernst wirst du später Erfolg haben" ... Mag sein, ich mache mir die Dinge zu einfach, doch für mich liegt die Parallele auf der Hand: „Kauf dies, kauf das – mach mit, sei dabei! ..."
Meine Gedanken fliegen wie Herbstlaub durch die Strassen meiner Gehirnwindungen. Zwischendurch versuche ich schreibend etwas Ordnung in das Durcheinander zu bringen. Der Schritt von der Werbung zum Fernsehen und zur zunehmenden Unwirklichkeit unserer Wirklichkeit liegt nahe: Fernsehkonsum als Droge ... in den 1970er Jahren eine Stunde täglich; heute bei Kindern und Jugendlichen in den USA und (West)-Europa je nach Art der Rechnung 3 bis 4 Stunden pro Tag. Dazu kommen Computer-Games und das Leben in den virtuellen Welten der Chatrooms und ähnliche Angebote. Die Auswirkungen auf die Wahrnemungs- und Bewegungsfähigkeit von Kindern, die schon früh fernsehen, sind gravierend ... Ich lese, notiere, sammle. So Gott will (und Gilbert hilft) wird das ganze wirklich einmal ein Buch ... Die Titanik sinkt; wir amüsieren uns zu Tode.