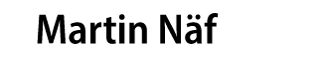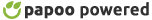Verzeihung, ist das der Weg nach Genf? Ein Experiment zum Thema Be- und Enthinderung
Vorspiel
So viel ich in meinem Leben bis heute auch gewandert bin, so wenig habe ich je daran gedacht, mich ohne sehende Begleiter hinaus in die offene Natur zu wagen, in Gegenden, wo ich die Wege nicht kenne und mich nur nach Gefühl bewegen kann. Dabei war immer klar, dass "die andern" für den Weg zuständig waren. Sie hielten nach Wegweisern oder einem guten Plätzchen für eine Rast Ausschau; sie gingen voraus, wenn die Wege schmal und für meinen weissen Stock nur schwer spürbar waren; sie schauten sich nach dem Bahnhof oder der Busstation um, wenn wir nach vier oder acht Stunden an unserem Ziel waren ... Es war eine Rollenteilung ähnlich wie zwischen Erwachsenen und Kindern, für mich angenehm, doch zuweilen auch etwas langweilig. Hie und da war ich auch mit einem oder zwei blinden Freunden unterwegs gewesen, doch stand dabei die Lust am Erproben unserer pfadfinderischen Fähigkeiten so sehr im Vordergrund, dass ich diese Ausflüge nie in den grossen Topf meiner Wandererlebnisse geworfen habe.
Diese Situation änderte sich im vergangenen Sommer schlagartig, als ich von einem sprachgesteuerten Navigationssystem namens Kapten hörte. Das für den kommerziellen Markt entwickelte Gerät hat keinen Bildschirm. Es wird über ein Mikrophon und über Sprachbefehle gesteuert, und gibt alle Anweisungen per Sprache weiter. Damit sei es auch für blinde Menschen bedien- und benutzbar. Obschon ich nicht unbedingt ein Freund solcher Gatchets bin, hat mich die Idee, an der Hand einer weit oben im Himmel tronenden Fee ganz allein über Berg und Tal spazieren zu können, sofort fasziniert, und ich habe mir so ein Gerät zur Ansicht kommen lassen. Die Ergebnisse nach einigen Testwanderungen in der näheren Umgebung von Basel waren zwar eher ernüchternd: Der Kapten kennt zwar einen sogenannten Fussgängermodus, doch da er im Prinzip nur mit Autokarten arbeitet, hilft die Stimme im Ohr wenig, wenn es um namenlose Forst- und Feldwege und um eigentliche Wanderwege geht. Dennoch! Das Ding hat mich im Laufe des Sommers ein paar mall zu Wanderungen verlockt, die ich ohne es nicht unternommen hätte, und es ist wohl auch schuld daran, dass ich Ende September plötzlich die Idee hatte: Warum versuchst du nicht diesen Jura Höhenweg!
Der Gedanke faszinierte und erschreckte mich zugleich: Allein unterwegs,, ohne die all gegenwärtigen Wegweiser sehen und die hilfreichen Wanderkarten lesen zu können! Kein Ausflug von ein paar Stunden, sondern eine "richtige Wanderung"! mitten zwischen Bäumen und Kühen und sonst nichts -, wie würde das gehen? Wie würde ich vorankommen?
Für einen gewöhnlichen Wanderer mag der Jura bloss ein harmloses mit Dörfern und Strassen übersähtes Stück Feld- und Wiesenlandschaft sein, doch für mich war es als ob ich in eine unerschlossene Wildnis aufbreche. Wegweiser würde es in meinem Jura nicht geben, und auch auf Reliefkarten für den blinden Wanderer musste icch verzichten, da es so etwas einfach nicht gibt. Immerhin hatte ich eine Liste der wichtigsten Orte, an denen ich vorüberkommen müsste, bei mir, und dank der sieben Jahre erlittenen Pflichtfranzösisch in der Schule würde ich mich auch mit den Eingeborenen einigermassen verständigen können. Dazu kam derkleineKapten, eher ein Maskottchen als ein wirkliches Hilfsmittel, und ein tastbarer Kompass, den mir ein Freund in letzter Minute geschenkt hatte. Nach einigem Hin und Her hatte ich mich ausserdem entschlossen, ein Zelt mitzunehmen, denn obschon ich meine Abende und Nächte viel lieber in einem gemütlichen Gasthaus zubringe als in einem engen und klammen Zelt, das man zudem noch den ganzen Tag mit sich herumschleppen muss, konnte ich doch nicht damit rechnen, dass diese Gasthäuser auch jeden Tag pünktlich zum Abendessen an der von mir gewünschten Stelle auftauchen würden! Zum Zelt kamen ein warmer Schlafsack und eine jener dekadenten Matten, mit denen der verweichlichte Wanderer von heute sich gerne gegen die Kälte des nächtlichen Bodens schützt. Dann natürlich warme Kleider sowie eine Flasche mit Wasser und zwei Päckchen Rosinen, ein halbes Kilo Datteln, zwei Tafeln Schokolade, 30 Portionen Pulverkaffee,zwei sterile Gasen, ein Verband, einen Regenschutz für mich und meinen Rucksack, mein Netbook und einen MP3-Player für die abendliche Lektüre, ein Taschenmesser sowie last but not least eine kleine irische Flöte, mit der ich dem unternehmen den Anschein unbeschwerter Wandervogelromantik geben wollte.
Am 4. Oktober kurz nach 10 Uhr stand ich in Aesch, dem Ende der Tramlinie 11, die mich aus Basel herausgebracht hatte. Die Sonne schien, und ich war guten Mutes. Das Experiment konnte beginnen.
4. Oktober 2010, 1. Tag
Mit Hilfe einer freundlichen Frau und meines GPS' war ich nach etwa einer halben Stunde in Pfäffingen, dem ersten, oberhalb von Aesch gelegenen Ort auf meiner Route. Unterwegs habe ich meine Hände zwei drei mal auf Entdeckungsreise gehen lassen, denn ich hatte mir vorgenommen, mir die Gegenden, durch die ich wandern würde, auch anzuschauen. Ich fühlte mit Effeu oder ähnlichen Schlingpflanzen bewachsene Mauern, ein paar Büsche und mehr Mauern. Alles, auch die relative Ruhe, suggerierten gepflegte Einfamilienhäuserromantik. Mein Verhalten war vorbildlich und entsprach ganz meinem edlenVorsatz: Sei immer im hier und jetzt, lass die Sorgen über den künftigen Weg nicht Herr im Hause deiner Seele werden! Sei offen für deine Umgebung und nimm sie auf deine Weise wahr - über die Haut, die Ohren, die Hände, die Nase und sogar den Mund! Ja, leg dich auf den Waldboden, spüre die Kühle der Erde und rieche das modrige Laub! Lass deine Hände erkunden, was es zu erkunden gibt. Streichle die glitschige Schnecke und liebkose der Wurzeln wirres Geflecht! Leckke am Stamm der Eiche und lege deine Wange an den rauhen Fels! Lass die Sorge um die Zukunft nicht das Jetzt überwuchern! Denke daran, der Weg ist das Ziel ... Aber - Wo ist der Weg? Und wie ist es mit der Sorge um dden Weg, ist nicht auch sie ein Teil des Weges und damit auch ein Teil des Zieles.
Ein friedlicher und neugieriger Mensch hatte mir am Dorfeingang erklärt, dass ich am Ortsausgang von Pfäffingen links ab müsse. Nicht zu verpassen. Eine kleine Strasse hoch zur Bergmatt. Und jetzt war es da, das Ende des Dorfes, aber die Strasse ... Oder war ich vielleicht noch mitten im Dorf? Hatte der Mann nicht gesagt, ich solle ...? Ob ich schonn zu weit gegangen bin ... Sollte ich vielleicht umkehren? Aber er hatte doch etwas von einem Apfelverkaufsstand gesagt. Weshalb habe ich nicht genauer nachgefragt ... Von meinem Interesse an den diversen Mauern und Mäuerchen ist bald nichts mehr übrig, denn ich will ja wohin kommen und nicht nur den ganzen Tag auf der Erde liegen und irgendwelche Würmer liebkosen.
Während ich rätsle und suche hält ein Auto neben mir. Der freundliche Mensch von vorhin steigt aus und zeigt mir die geheimnisvolle kleine Strasse, nach der ich vergebens gesucht habe. Dieses mich verirren und verwirren und mich wieder finden wird zur Grundmelodie der nächsten Tage: Frohes Spazieren und Zuversicht wechseln mit Unsicherheit und steigendem Missmut, wenn ich merke oder fürchte, dass ich vom rechten Weg abgekommen bin. Ich mache mir Sorgen, versuche ruhig zu bleiben, und plötzlich löst sich das Problem, ohne dass ich die jeweilige Lösung voraussehen könnte. Ich versuche, gelassen zu bleiben,auch wenn ich nicht weiss, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin. Die Übung ist nicht einfach, doch sie gefällt mir, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie mir ganz gut tut.
An diesem ersten Tag bin ich mit Hilfe meines Kompasses und der Informationen einiger Menschen, die ich unterwegs angetroffen und befragt habe, von Aesch via Pfäffingen, Bergmatt, Platten nach Metzerlen gewandert. Von dort aus ein Stück der Challstrasse entlang in Richtung Challhöhe. Nach ca. 20 Minuten auf einen Feldweg rechts abgezweigt, der mich schliesslich aber wieder ins Tal und auf die Strasse nach Burg geführt hat. Der Versuch zurück auf die Challstrasse zu gelangen ging völlig schief; statt dort stand ich nach einer weiteren halben Stunde genau dort, wo ich nicht hinwollte - in Burg. Burg! Wie hatte das geschehen können? Die Sache war schon so absurd, dass ich mehr lachte als mich ärgerte. Eine Weile spielte ich mit dem Gedanken, einfach quer Feld ein bergaufwärts zu gehen, denn dort oben war sie ja, die berühmte Challhöhe. Auf Rat eines freundlichen Menschen ging ich dann aber doch zurück nach Metzerlen und erneut die Challstrasse entlang. Diesmal bis ganz rauf, ca. 4 oder 5 mühsame, langweilige Kilometer.
Insider wissen es, und mir war es auch klar: Ich hatte einen riesigen und unnötigen Umweg gemacht. Statt vom Plattenpass nach Metzerlen hinunterzugehen und dort meine überflüssigen Kreise zu drehen, hätte ich ohne Höhe zu verlieren direkt auf die Challhöhe wandern können, doch an der entscheidenden Stelle war niemand, den ich hätte fragen können, und danach, als es so lange und angenehm bergab ging, wollte ich nicht mehr umkehren, denn wer weiss denn sicher, ob Umkehren wirklich die richtige Lösung ist und ob ich den Einstieg zum direkten Weg ohne Hilfe jemals finden würde.
Ich hatte ausgiebig Zeit in schlechter Laune vor mich hinzubrüten und mich meines Ungemachs wegen zu bemitleiden, während ein paar späte Heimkehrer herzlos an mir vorüber zur Passhöhe fuhren. Hie und da gab ich mir einen ruck, versuchte heiter zu sein und ein wenig schneller zu gehen, doch der Rucksack war schwer und die Passhöhe schien nicht kommen zu wollen. Herrlich, diese seelische Herausforderung, diese Chance zu innerem Wachstum! Doch noch herrlicher wäre es wenn ich endlich auf der Passhöhe wäre!
Da: Die Strasse wird flach, und hier ist auch der Weg, der laut meinen Informationen rechts abgehen muss! Die schlechte Laune von eben verflüchtigte sich im Nu. Der Weg war angenehm, und mein Rucksack leicht wie ein Packen Vogelfedern. Ich war stolz auf meinen kleinen Etappensieg. Natürlich. Der Umweg. Ich grollte noch immer ein wenig, doch je weiter ich mich von der Passtrasse entfernte, desto fröhlicher wurde das Gezwitscher meiner Gedanken.
Nach ca. 20 Minuten begann ich nach einem geeigneten Platz für mein Zelt ausschau zu halten. Dieses "nach einem geeigneten Platz Ausschau halten" stellte sich in den nächsten Tagen noch öfter als relativ aufwändiges Unterfangen heraus, denn während ein sehender mensch seine Blicke grosszügig über die Umgebung schweifen lassen kann, muss ich diese Umgebung mit meinem Stock Meter für Meter erkunden: Hier sind Büsche. Hier noch mehr Büsche. Hier liegen ein paar Baumstämme. Soll ich über sie rübersteigen und dahinter weiter suchen oder zurück zum Weg und noch ein Stück gehen? Vielleicht hier? Nein. Wiedr Büsche und Hier? Zu viel dürres Geäst auf der Erde, aber hier, hier könnte es gehen oder doch nicht?
Wo ich suchte war dichtes Unterholz und viel dürre Äste und Steine. Doch schliesslich fand ich vier flache und astfreie Quadratmeter und stellte mein zelt auf. Es ging langsam, weil ich mich nach der 9 oder 10stündigen Wanderei nicht mehr so recht bewegen konnte und wollte, und weil ich das Zelt vorher noch nie aufgebaut hatte. Es ging auch langsam, weil ich sehr bewusst darauf geachtet habe,, meine Sachen und meine Geddanken zusammenzuhalten und sie nicht überall hin zu verstreuen, wo ich sie am nächsten Tag dann mühsam und mit ungewissem Erfolg zusammensuchen müsste. In der Nacht regnete es ein wenig. Im Zelt war's trocken und warm.
5. Oktober 2010, 2. Tag
Ich hatte gut geschlafen, war gegen acht aufgestanden und hatte das zelt abgebaut. Dann ging's weiter auf dem Weg, auf dem ich am Abend gegangen war. Ein Spaziergänger - der einzige, dem ich während Stunden begegnet bin! - wies den Weg: Weiter gerade aus, bis Sie an einer grossen Weide vorbei kommen, danach den linken, langsam bergabführenden Weg wählen ... - Die Weide kam mir zwar nicht gross vor, doch ich hatte die Abzweigung offenbar gefunden, denn die weiteren Prophezeiungen des Mannes trafen nach und nach alle ein: der weg war nach ca. 30 Minuten geteert. Ich kam auf einer Alp vorbei (Remel) und danach ging's weiter bergab. Ein ganz und gar friedlicher Abstieg. Unglaublich stilll. Angenehme Luft. Hie und da ein Vogel. Zwischendurch wdie Sonne. Viel Wald. Während der Frühstückspause packe ich das Aussenzelt ein, welches ich zum Trocknen quer über meinen Rucksack gebunden habe. Ich esse zwei Baslerleckerli und bin zufrieden.
Kurz bevor ich auf die Hauptstrasse nach Kleinlützel kam, traf ich ein holzspaltendes Ehepaar, welches mir Hinweise für den weiteren Weg nach Monvelier gab. Auf der Hauptstrasse scheiterte ich dann allerdings bald kläglich, suchte in einer Sägerei vergeblich nach dem versprochenen Weg und liess mich von dortigen Chef schliesslich für eine andere Route begeistern: der Strasse entlang zum "neuen Zoll", ungefähr 2 km, nach weiteren hundert Metern links runter und über eine Brücke, dann drüben ca. 30 bis 40 Minuten den Berg hoch. Oben sei der Weg geteert und führe schliesslich in die Hauptstrasse zwischen Roggenburg und Ederswiler. Von dort sei's nicht mehr weit bis Monvelier. - Klang einfach, nur dass an der prophezeiten Stelle kein Weg und keine Brücke waren. Ich ging ein paar mal hin und her, runter zu verlassenen Schuppen und um alte Garagen herum, ging ein gutes Stück zurück und suchte noch einmal. Wiederum kein Erfolg. Nirgends der versprochene Weg. Schliesslich, nach dreiviertelstündiger Suche ein Automobilist, der mir den Weg zeigte: 5 meter weiter als ich gegangen war, viel weniger Steil und wesentlich breiter als ich nach den erhaltenen Beschreibungen geglaubt hatte, aber doch offensichtlich der Weg, den ich brauchte. Oder doch nicht? Da kam zwar der Bach, und irgendwie hatte ich ihn wohl auch überquert, aber war das eine Brücke gewesen? So ganz sicher war ich mir nicht.
Doch immerhin. Es ging, wie voraus gesagt,aufwärts. Und zwar nicht zu knapp! Ich schwitzte und keuchte. Die Sonne brannte. Wenn das bloss der richtige Weg ist!
In einem Gehöft, in dem ich nach etwa 20 Minuten gelandet war, sagt mir ein polnischer Arbeiter, es gehe kein Weg ganz hinauf, alles privat, nur bis hierher und bis zu einem anderen Hof. Kein ganz hinauf. Nicht möglich. - Ich versuche alles, aber er bleibt dabei: Kein weg. Alles privat.
Ich kehre entmutigt um, nehme dann aber auf gut Glück eine Abzweigung, die mir vorher gar nicht aufgefallen war. Es geht weiter steil aufwärts. Vielleicht zu dem anderen Hof, von dem der Arbeiter gesprochen hatte?Tatsächlich. Da ist ein Hof und lautes Hundegebell. Ich umkurve das Haus und gehe weiter. Nach fünf Minuten stehe ich voor einem dicken Eisengatter. Ich bin noch immer beeindruckt von dem "privat", "privat" des polnischen Arbeiters und traue mich nicht weiterzugehen. Ich mache Pause. Nach etwa einer halben Stunde hält ein Auto beim Hof. Ich gehe zurück und rede mit dem Bauern, der von seiner Arbeit kommt. Er bestätigt mir, dass der Weg tatsächlich weitergeht, über die Weide und danach noch ein Stück bbergan. Der Weg sei aber schlecht, ja und die Kühe, die seien eben auch da, und oben, da komme dann wieder ein Gatter ... Wir sprachen noch ein wenig von seinem Hof und dem harten Leben im Winter. Er war fasziniert von meinem Mut, wie er es nannte, und schliesslich verabschiedete ich mich mit frish gefüllter Wasserflasche und neuem ... na, soll man sagen "Mut" oder neu belebter Entschlossenheit?
Tatsächlich verlief danach alles, wie vorhergesagt. Auf der Höhe empfing mich ein zweiter staunender Bauer, und das folgende Strässchen war - obgleich geteert - absolut idyllisch und leicht zu gehen. Auch die Hauptstrasse nach Ederswiler war ganz ruhig. Kaum Verkehr und kein Lärm aus irgend einem Tal. Nur Sonne und Schatten und hie und da ein angenehmer kühler Wind.
In Ederswiler traf ich zwei Ausflügler, die dort auf den Bus zurück in die Zivilisation warteten. Der Mann erklärte mir grossmütig, dass man sich in der Schweiz nicht verirren könne. Er wisse das, und er wisse, was es heisse zu sehen und nicht zu sehen.
Der Mann hatte offenbar nicht den halben Tag mit dem mühsamen Suchen irgendwelcher Abzweigungen verbracht, die jeder sehende Depp ohne Probleme sehen kann. Ich reagierte deshalb etwas gereizt auf sein esoterisches Gefasel, woraus er vermutlich schloss, dass ich noch viel zu lernen habe auf dieser Erde. Und natürlich hat er recht, denn der Weg ist das Ziel und der Umweg ist die Abkürzung, und wo du auch immer bist, du bist auf deinem Weg! Der Guru in mir lächelt. Er liebt diese Töne, doch mein unfertiges Ich wird noch immer leicht rebellisch, wenn es den Eindruck hat, von einem gelangweilten Gott zur Befriedigung seiner Launen benützt zu werden.
Von Ederswiler nach Monvelier ist's nicht weit, eine knappe Stunde vielleicht. Monvelier wirkt langweilig, ein wenig wie ein künstlich hingebauter Einfamilienhäuslevorort von Delemont. Dazu ist das Restaurant, auf das ich einige Hoffnungen gesetzt habe, dienstags geschlossen.Immerhin: Der laden war noch offen, sodass ich mich mit neuem Proviant und einem Fläschchen Wein eindecken konnte. Danach ging's weiter in Richtung Pleigne, dem nächsten Dorf.
Sobald das Dorf hinter mir liegt, beginne ich wieder, eine gemütliche Ecke zum Übernachten zu finden. Ich gehe einn paar mal links und rechts von der kleinen Strasse weg, gehe über eine ziemlich steile Weide hinauf zu einem Waldrand, gehe dem Waldrand entlang und kehre schliesslich um. Nichts zu machen, Alles zu steil. Nach fünf Minuten versuche ich es noch einmal an einer anderen Stelle, mit meinem Stock immer weit nach links und rechts ausgreifend, um endlich irgendwo ein flaches Stück Erde zu finden. Doch so was scheint es hier herum nicht zu geben.
Schliesslich entscheide ich mich für ein Stückchen Weide an einem grossen Hang oberhalb der Strasse, welches mir etwas weniger abschüssig als das übrige Gelände erscheint. Für das Zelt ist der Platz ungeeignet, doch hatte ich ohnehin schon halb und halb beschlossen, diese Nacht unter offenem Himmel zu schlafen. Es war den ganzen Tag warm und sonnig gewesen, und auch in der Nacht würde es kaum regnen.
Es war ein alles in allem guter Tag gewesen, denn - naja, ich war hier und das war gut. Ich sass neben meinem Rucksack, ass ein paar der bewährten Leckerli, genoss den Wein und versank für eine Stunde in einem Krimi. Dann krabbelte ich in meinen Schlafsack und versuchte, zu schlafen. Ich hatte diesmal auf die Matratze verzichtet und stattdessen meine wasserdichte Pellerine als Unterlage über das feuchte Gras gebreitet. Doch was ich befürchtet hatte, trat ein. Die vom Boden her kommende Kälte liess mich nicht recht schlafen. Als ich schliesslich meine kleine Matratze aufgeblasen und mich darauf gelegt hatte, war's gemütlich warm, doch jetzt begann der Kampf mit der Schwerkraft, denn jedesmal wenn ich mich ein wenig bewegte, rutschte mein Schlafsack ein Stück den Berg hinunter ... Abgesehen davon war's aber eine gute Nacht. Die nahe Strasse war kaum befahren, auch am morgen nicht, als ich mich für einen neuen Tag zurechtrappelte.
6. Oktober 2010, 3. Tag
Der dritte Wandertag begann eigentlich in Pleigne, das ich nach etwa 40 Minuten erreichte. Ich sass dort in der Sonne vor dem geschlossenen Restaurant auf meinem zum Trocknen ausgebreiteten Schlafsack und genoss mein spezielles Survival Frühstück: Basler Leckerli und die Pulverkaffeebeutelchen, die ich jeweils mit ein oder zwei Schluck kalten Wasser in meinem Mund zu einem würzigen Kaffee mische ... Nicht gerade Number one in puncto Geschmack, doch der Aufweckeffekt wird eindeutig erzielt.
Pleigne hat mich sehr beeindruckt: Extrem ruhig und verschlafen. Viel weniger retortenhaft als das nur wenig km entfernte Monvelier.
Während meiner Rast befragte ich zwei Männer darüber, wie ich von Pleigne nach Les Rangiers komme. Die Auskünfte waren gut und mit Hilfe von GPS und einem weiteren Informanten, der wie vom Himmel geschickt an einer entscheidenden Wegstelle plötzlich auftauchte, war ich etwa anderthalb Stunden später auf einem kleinen Picknickplatz zwischen Pleigne und les Rangiers. Dort sprach ich mit einer Gruppe von Jägern, die sich sehr für meine Story interessierten und mich schliesslich zum Mittagessen einluden. Es gab Leber - ich glaube von selbst erlegten Wildschweinnen -, dazu Rösti und Salat, Wein und am Ende Kaffee und Keckse. Alles reichlich und alles sehr sehr lecker! Der älteste der fünf Jäger war 90 Jahre alt: "O oui, on a fait la mob".
Die fünf bestätigten, was ich inzwischen über meinen Weg nach les Rangiers wusste und so brach ich nach einer Stunde gestärkt auf: Runter auf die Hauptstrasse, dieser nach links folgen und nach ca. 50 bis 100 Metern in ein rechtsabgehendes Strässchen. Diesem Strässchen für ca. 3 km folgen bis zu einer Gabelung zwei bis dreihundert Meter hinter einem Bauernhof. Von dort auf dem links abgehenden Schotterweg noch einmal ungefähr 30 Minuten und man ist in Les Rangiers. An der Gabelung traf ich zwei Frauen aus Delemont, die mit ihren beiden Hunden auch auf dem Weg nach Les Rangiers waren. Sie nahmen mich bis dorthin mit und brachten mich dann gleich noch eine kleine Etappe weiter, bis nach la Caquerelle auf der Strasse von Delémont nach Porontruit. Dort zeigten sie mir noch den Einstieg zum Höhenweg nach St. Brais. Wunderbar. Ein paar Männer in einem vorbeikommenden Jeep gaben genauere Erklärungen: "Weiter auf diesem Weg. In ungefähr 800 metern kommt links ein Metallgatter, dort durch und dann immer weiter. Wenn der Weg runter geht, sind Sie zu Weit." Es klang einfach und wurde doch bald der Frust des Jahres. Der Weg begann runter zu gehen ohne dass da ein Metallgatter gewesen wäre. Also noch einmal zurück. Immer noch kein Gatter. Sollte ich ein wenig weiter gehen. Vielleicht ging es ja nicht wirklich runter, wo ich umgekehrt war. Also ein Stück weiter. Immer noch kein Gatter. Wieder zurück und wieder vorwärts. Diesmal verlor sich der Weg im Gestrüpp. War ich auf einen falschen Weg geraten. Seit der Jeep an mir vorbeigefahren war, war ungefähr eine Stunde vergangen. Seither kein Lebenszeichen, jedenfalls kein menschliches, nur das tiefe Krächzen oder eher Schnarren irgend einer Krähenart und viel dürres, totes Holz. Ein paar heisse, feuchte Lichtungen und Müde Bäume ...
Nun ja, der Weg ist das Ziel und das paradies ist genau dort, wo du bist. Weshalb nicht hier sein. Weshalb so dringend auf einen Menschen hoffen, der mir weiterhilft? Ich sollte mein Schicksal gelassen hinnehmen, doch inzwischen war ich schon zwei Stunden in diesem Wald herumgeirrt ... Es brodelte wieder in mir. Selbstgespräche aller Art, mühsam gezähmte Ungeduld, Müdigkeit, zynische Kommentare über meine Sturheit, die mich zu solchen Experimenten verleitet und dann wieder beruhigende Worte und Galgenhumor ... Schliesslich begriff ich: Es ist wie es ist, und all dieses innere Hin und Her hilft nichts. Setz dich hin und entspanne dich. Wolltest du deinen Händen nicht alles zeigen, was um dich her ist? Wolltest du nicht die Erde riechen und das modrige Laub? Wolltest du nicht unter jeden Stein und in jedes Astloch greifen, um die dortigen Geheimnisse zu entdecken. Stattdessen rennst du seit zwei Stunden hin und her als ob es um dein Leben geht. Dabei scheint die Sonne, und du hast noch eine halbe Flasche Wasser und reichlich zu Essen in deinem Rucksack!
Ich sitze und beginne - noch immer eher lustlos - ein wenig im Laub um mich her zu graben. Da höre ich einen menschen ... Ich rufe: Allo, Allo, doch er geht an mir vorüber. Dort links scheint es noch einen Weg zu geben. Es ist wahrscheinlich mein ursprünglicher Weg, von dem ich unbemerkt abgekommen war. Das eröffnet wenigstens eine kleine Hoffnung. Ich nehme meinen Rucksack wieder auf und bin bald wieder auf meinem alten Weg, den ich deutlich erkennne. Er ist breiter und fester als der, auf dem ich die letzte Stunde vertrödelt habe. Endlich kommen auch zwei Mountainbiker. Doch doch, das Metallgatter sei da vorne. ich solle nur hinter ihnen herkommen. Sie würden beim Gatter auf mich warten ... ich trabe neu belebt hinter ihnen her, rauf und runter und noch ein wenig rauf und runter. Schon fürchte ich, meine Retter wieder verloren zu haben, da höre ich sie vor mir. hier ist das Gatter. Ein gutes Stück weiter als ich es erwartet hatte. Und hier gehe es jetzt rauf. Ach sie würden ein Stück mit mir kommen, denn da oben gäb's noch ein zweites Gatter und dann könnten sie mir auch gleich sagen, wie's weiter geht. Ob ich tatsächlich zufuss von Basel bis hierher gekommen sei und ob ich tatsächlich nichts sehe ... Verrückt finden sie es, und cool, und ich frage mich, in wie weit ich solche Dinge eigentlich genau wegen der Anerkennung tue, die icch aus solchen Worten heraushöre.
Beim zweiten Gatter trennen wir uns: Noch ungefähr 500 Meter bis zu einem Bauernhof, danach geht der Weg weiter bis St. Brais, vielleicht noch zwei oder drei Stunden.
Der Weg im Gras ist gut spürbar, ja geradezu ideal für meinen in ihm wie in einer Dachrinne dahingleitenden weissen Stock. Ich bin hoch zufrieden! Alles was vorher war ist vergessen!Zweifel und Sorgen gibt's keine. Schöne Gegend, angenehm still. Gute Luft. Beim Bauernhof ist's dann leider bereits wieder vorbei mit der Idylle. Ich gerate zwischen irgendwelche Maschinen und Gebäude, Auf- und Abfahrten. Wo geht's hier nur weiter. Irgendwo bellt der obligate Hund. Zum Glück bin ich in der Richtung nicht sehr ängstlich. Ich red mit dem Vieh, dass es mir doch den Weg zeigen könnte, statt mich mit seinem Gebell nervös zu machen. Das Vieh bellt munter weiter. Während ich noch immer nach der Fortsetzung des Weges suche, merke ich, dass da auch ein Mensch ist. Ich spreche ihn an. Wie lange hat er mir wohl schon zugeschaut. Er beginnt langsam aus seiner Zuschauertrance zu erwachen. "Ja ja, mer chönne doch dütsch rede. Ja ja. I chane das scho rede, de dütsch. Jo aber, doch, nei. Aber für ihne isch es besser, uf dSchtrass abezgoh. Nit do dure Wald. Das goht nit. Das isch zgföhrlig ...". Ich versuche mehr über diese Gefahren herauszufinden, will eigentlich lieber auf meinem schönen Wanderweg bleiben, doch er wiederholt nur immer, dass er ja auch deutsch könne und dass die Strasse für mich besser sei. In Erinnerung an meine zwei verhexten Stunden in dem nachmittäglichen Wald gebe ich schliesslich auf, und er gibt mir die Instruktionen für den Weg via Strasse: Runter ungefähr zwei oder drei Kilometer, dann etwa 8 km auf der Hauptstrasse bis St. Brais.
Die Strasse entpuppte sich als widerlich. Bis runter ins Tal ging es. Auch die Hauptstrasse war anfänglich okay, doch nach etwa zwei km wurde sie eng und begann zu steigen. Lauter unübersichtliche Kurven entlang der rechten Flanke des Tales und überraschend viel Verkehr. Rechts immer wieder Fels und nur wenig Platz für mich. Dann als weitere Delikatesse ein paar Tunnels. Ob's auf der anderen Strassenseite ein Trottoir oder vielleicht sogar einen aussen herum führenden Weg für Fussgänger gibt? Keine Ahnung. Während ich weitergehe fühle ich rechts den Fels. Der Tunnel wirkt sehr eng; zu eng für mich und die vorbeirasenden Autos. Glücklicherweise ist er nur kurz. Aber was, wenn ein solcher Tunnel statt 15 oder 20 meter plötzlich zwei oder dreihundert Meter lang ist, und ich mitten drin stecke, bevor ich begreife, dass ich nicht hier sein sollte. Ich fühle mich unbehaglich. Mag sein, dass ich ein mutiger Mensch bin. Viele haben das in den letzten Tagen zu mir gesaagt, aber ich weiss auch, was gefährlich ist, und ich bin weder suizidal noch unnötig unvorsichtig.
St. Brès will irgendwie nicht näher kommen. Ich befrage mein GPS alle fünf oder zehn Minuten über die Distanz bis zum Zielort. ich bin müde. Die Autos sind anstrengend. Sie fahren schnell und oft sehr nah an mir vorbei. Es ist bereits halb acht, trotzdem nimmt der Verkehr nicht ab. Im Gegenteil. Es wird eher noch schlimmer damit.
Obschon ich nicht darauf zähle, staune ich doch darüber, dass niemand anhält. Da, wo ich die Menschen persönlich treffe, sind sie in der Regel äusserst hilfsbereit und durchaus nicht gleichgültig. Es mag ein paar Augenblicke dauern, bis der Kontakt hergestellt ist und sie begreifen, was ich will, doch dann sind sie, wie gesagt, meist sehr hilfsbereit und interessiert. Doch sobald sie in ihren Blechkisten sitzen, scheinen sie anders zu funktionieren. Sie haben ein Ziel, ein Armaturenbrett, ein Steuerrad und die vor ihnen liegende Strasse. Sie sehen mich zwar, einen Mann mit einem weissen Stock und einem grossen Rucksack kilometer entfernt vom nächsten Dorf auf einer engen Überlandstrasse, doch obwohl sie mich sehen und obwohl sie sich vielleicht einen Augenblick lang fragen, was dieser Mann da tut, bin ich für sie kein realer Mensch mehr. Sie fahren an mir vorbei, ohne dass sie auf mich reagieren. Wie gesagt: Ich erwarte es nicht, doch so selbstverständlich diese Situation scheint, so abnormal ist sie doch im Grunde. Ich denke über das Selbstverständliche nach, darüber, dass bei uns niemand mehr zu Fuss von Dorf zu Dorf ghet, dass alle mit dem Auto oder dem Buss zur Arbeit und nach hause fahren. Ich denke an die zahlreichen Menschen, die sich am Rande indischer oder afrikanischr Landstrassen bewegen. Wir hier haben Geld. Wir setzen uns in einen Bus oder noch besser in ein Auto. Ein Volk von hochgerüsteten Autisten und Autistinnen, die dabei die Rohölreserven der Welt aufzehren. Schnell geht alles vor sich und in grosser isolation: ohne Kontakt mit der Umgebung. Nicht einmal ein relativ starkes Signal, wie ich es auf dieser Strasse bin, löst eine für mich wahrnehmbare Reaktion aus. Wir leben in zwei Welten,
Gegen acht beginne ich ohne Erfolg nach einem Schlafplatz Ausschau zu halten. Es ist alles zu steil und zu eng. Rechts von mir meist nur Fels oder steile Böschungen. Hie und da ein halber Meter grünstreifen, der einigermassen flach ist. Da endlich. Der Grünstreifen ist fast zwei Meter breit. Er wird für mich und meinen Schlafsack ausreichen. Ich beginne mich für die Nacht einzurichten. Die Autos fahren einen Meter vor mir durch, doch was soll's. Für mich ist der Platz okay.
Zehn Minuten später liege ich in meinen Kleidern im Schlafsack. Die Nacht ist angenehm warm. Den ganzen Tag über hat die Sonne geschienen. Ich schlafe noch nicht, sondern mühe mich mit einem Krimi von Jo Nesbö ab als ein Wagen neben mir anhält. Polizei. Die zwei Männer sind freundlich. Was ich hier tue und wer ich sei. Ich erkläre ihnen, das ich keinen besseren Ort zum schlafen gefunden habe. Sie verstehen, sind aber doch etwas beunruhigt. Es sei so nah bei der Strasse. Ob sie mich nicht zu einer etwa 300 meter weiter entfernten, nicht mehr betriebenen Diskothek bringen dürften. Dort gäbe es ein grosses Dach, sodass ich auch vor einem eventuellen Regenguss sicher sei. Ich bin einverstanden und krabble aus meinem Schlafsack. Wir machen uns auf den Weg. Sie sind wirklich freundlich, die beiden,und der neue Platz ist angenehm. Viel ruhiger und auch privater. Ich Schlafe gut.
7. Oktober 2010, 4. Tag
Wie jeden morgen stehe ich auch heute relativ spät auf und bis ich wirklich weg komme ist es etwa halb zehn. Nach einer halben Stunde bin ich in St. Brais. Ich frage nach einem Restaurant, da ich Lust auf einen guten Kaffee habe. Fehlanzeige. Vor ein paar Jahren, ja da hätten sie noch ein Restaurant gehabt, sogar zwei; auch ein Hotel, aber heute ...Immerhin, einen Laden hätten sie noch und dort gäbe es auch Kaffee. Die Frau, die mir dies erzählt, bringt mich hin und verabschiedet sich.
Ich verbringe eine halbe Stunde in dem stillen Hinterzimmer des Ladens und rede ein wenig mit seiner Inhaberin. Ja, die Restaurants hätten alle zugemacht, das letzzte vor einem Jahr. Die Strasse sei wirklich schlimm. Natürlich gäbe es einen Bus, aber im Grunde laufe hier nichts ohne Auto.
Die etwa 5 km zwischen St. Brais und Monfaucon lege ich auf einem links neben der Hauptstrasse verlaufenden Weg zurück, den mir ein anderer Gast im Laden empfohlen hat.Der weg werde heute als Fahrradweg benützt. Er führe bis Monfaucon. Ich bedanke mich, bezahle und bitte die Ladeninhaberin, meine Wasserflasche zu füllen. Es gibt wenig Brunnen im Jura, sodass einem das Wasser leichter als an anderen orten ausgehen kann.
Am Dorfende zeigt mir ein Junge den Beginn des Fahrradwegs, ein langweiliges Strässchen, welches sich nie mher als hundert Meter von der Hauptstrasse entfernt. Als ich schon beinahe in Monfaucon bin, stehe ich vor einer Weggabelung. Ich entferne mich von der ziemlich befahrenen Strasse. Der weg wird immer angenehmer. Statt Autos höre ich Vögel und still vor sich hinschnaubende Kühe. Ich fürchte allerdings, dass es nicht mein Weg ist. Nach etwa 20 Minuten lande ich bei einem Bauernhof, wo mir eine etwas beleidigt klingende Frau bestätigt, dass es hier nicht weiter gehe, jedenfalls nicht in Richtung Monfaucon. Also kehre ich um und finde schliesslich das letzte Stück des verlorenen Fahrradweges. In Monfaucon werde ich zum Reckadorf hinaufgewiesen, wo es einen schönen Weg nach Le Bémont gäbe. Von dort seien es dann noch ungefähr 2 km bis Saignelégier, die man auf der Hauptstrasse gehen muss. Allerdings gäbe es ein Trotoir. Ich finde den empfohlenen Weg diesmal ohne Komplikationen. Zwei hilfreiche Männer standen an genau dem richtigen Punkt bereit und halfen weiter.
Die ersten 20 Meter des so glücklich gefundenen, angeblich so schönen Weges waren tatsächlich wunderbar. Ein gut spürbarer Pfad durch eine Weide. Mein Stock glitt vor mir her, wie wenn der Pfad nur für den Zweck gemacht wäre, blinden Wanderern als Leitlinie zu dienen. Das Glück dauerte allerdings nicht lange. Nach hundert Metern hatte ich den Pfad ein erstes Mal verloren. Er war bloss noch eine kaum spürbare Spur im Gras. Der romantische Spaziergang durch die berühmten Juraweiden wurde immer mehr zur Geduldsprobe. Vorsichtiges fühlen, etwas hangaufwärts, etwas hangabwärts. Ich war doch eben noch auf dem Weg? Hier, dieser Stein, er könnte der Weg sein. Nein. Scheisse. ich stehe vor einer Tanne. Schön, wie diese Baumgruppen auf den Weiden stehen, nur wie umrunde ich sie. Hopla, offenbar nicht rechts herum. Ja, so ist's besser. Aber wo ist mein Weg. Vielleicht hier? Ja, tatsächlich hier ... nein, doch nicht. Ich höre den Verkehr nach Saignelégier links von mir. Die Strasse scheint nicht sehr weit. Dass sie da ist beruhigt mich, denn damit weiss ich, was ich tun kann, wenn ich von dieser Sucherei genug habe. Ich hoffe auf andere Wanderer, an deren Bewegung ich mich orientieren und die ich um Hilfe bitten könnte. Vor zehn Minuten war mir eine Familie entgegengekommen, doch da hatte ich den Weg gerade wiedermal gefunden, aber jetzt ... Kein Mensch weit und breit. Jedenfalls höre ich niemanden. Wandern ist offenbar nicht mehr in, obwohl da drunten in den Tälern doch Ferien sind.
Nach etwa einer Stunde habe ich vielleicht die Hälfte des Weges nach le Bémont zurückgelegt. Dann habe ich genug von diesem Geduldspiel und ich beschliesse, zur Strasse hinabzusteigen. Es wird ein ziemliches Gekraxel durch dichtes Unterholz und unter zwei Zäunen durch, doch es ist eine andere Art von Geduldsprobe. Hier fühle ich mich nicht unbeholfen. Ich höre mein Ziel und meine Hände sehen das Unterholz und den Stacheldraht. Ich bin nicht ungeschickt, sobald ich Körperkontakt mit meinen Hindernissen habe und weiss, in welche Richtung ich will oder muss. Nach 10 Minuten bin ich auf der Strasse und nach einer weiteren Stunde habe ich saignelégier erreicht. Unterwegs habe ich beschlossen, dass ich diese Nacht wenn immer möglich in der Zivilisation verbringen will.
Der Krach im Zentrum von Saignelégier ist unglaublich. Ich stehe wie betäubt an einer kreuzung. Es scheint als ob mindestens sechs Landwirtschaftsmaschinen und sechs Lastwagen gleichzeitig um die Herrschaft über den Platz kämpfen. Zwischen dem Gebrüll dieser Dinosaurier höre ich ein eigentümliches Klappern, ganz leise. Es erinnert irgendwie an das Geräusch eines Brunnens.Ich horche lange, doch erst als der Kampf der Dinosaurier vorüber ist und sie sich fauchend in verschiedene Richtungen entfernen, höre ich es: Es ist wirklich ein Brunnen und da sind auch menschen, die miteinander schwatzen. Uff! Es werde Licht! ich frage nach einem Hotel und ein junger Mann begleitet mich auf der Suche. Der erste Ort ist voll, doch am zweiten Ort gibt's Platz. Das Massenlager oder Dormtoir des Centre loisir de Saignelégier. Mein Begleiter hatte mir angeboten, dass ich auch bei ihnen schlafen könne, dass ich dann aber ziemlich früh raus müsse, da er und seine Freundin Besuch aus Berlin hätten, denen sie morgen ein Stück der Schweiz zeigen wollten. Ich sagte, ich sei ganz zufrieden, etwas für mich zu sein und einmal richtig ausschlafen zu können.
Das Centre Loisir erwies sich als gute Wahl: Extrem freundliche Menschen, und ein Bett im Dormtoir mit Frühstück für 27 Franken. Das Dormtoir entpuppte sich als einfaches Zweibettzimmer mit eigener Waschgelegenheit und Clo, welches ich ganz für mich hatte. Dazu gab's eine konfortable warme Dusche auf dem Flur, kostenlosen internetzugang im ganzen Haus und ein Restaurant mit gleichfalls äusserst freundlichem Personal.
8. Oktober 2010, 5. Tag
Nach dem Frühstück habe ich noch eine gute Stunde Tagebuch geschrieben. Die Erlebnisse der letzten Tage beschäftigen mich vielleicht mehr als ich wahrhaben will. Es fällt mir vor allem schwer, mit der Tatsache zurecht zu kommen, dass ich gerade die als besonders schön bezeichneten Wege oft nicht finde oder dass sie für mich und meinen Stock zu schwierig sind. Nicht wegen allfälliger Steinen oder Wurzheln, sondern weil sie nicht markant genug sind. Mit einem guten GPS ginge es vielleicht, aber ohne ein solches? Sicher. Ich komme voran, aber macht die Sache auch Spass? Während ich schreibe klärt sich der Himmel in mir, und meine Faszination für dieses Experiment kehrt zurück. Es geht nicht nur darum, ob es Spass macht. Die Sache fasziniert mich auch dann, wenn sie frustig oder langweilig ist, denn ... Ja weshalb eigentlich? Vielleicht weil ich dabei einiges über meine Art zu leben erfahre und einige wichtige Dinge üben kann? Dann wäre diese Wanderung also eine Art mentales und körperliches Training? Mental, indem ich lerne, gelassen zu bleiben, egal, ob ich eine Situation im Griff habe oder nicht. Eine Übung in angewandtem Gottvertrauen oder so etwas ähnliches also. Dazu auch eine Übung im Durchhalten. Einfach gehen,, weiter gehen ohne andauernd daran zu denken, wie weit es wohl noch ist und wie müde ich doch eigentlich bin. Das Hauptproblem sind offenbar die vielen Stimmen im Kopf, mit denen ich immer wieder zu tun habe. Sie reden so viel. Da ist der Sorgenmacher, mit seinen dauernden Sorgen, und der Romantiker mit seinen Sehnsüchten nach weichen Waldwegen und Vogelgezwitscher und vor allem der grosse Vergleicher, der immer wieder daran denkt, was ich tun und erleben würde, wenn ich sehen könnte. Er spricht nicht laut, denn er hat gelernt, sich klein zu machen. Doch wenn ich genau hinhöre, dann ist er immer da, und im Grunde meckert er immer. Er kann offenbar auch nach mehr als 40 Jahren noch nicht recht akzeptieren, dass ich nicht mehr sehe. Er ist ein Trottel, schwer von Begriff, aber er ist da mit seinem ewigen wenn wenn wenn. - Ich werde ärgerlich und zugleich - naja, er ist ein armer Kerl, muss zwischendurch vielleicht einmal in den Arm genommen werden.
Das Schreiben hat gut getan. Inzwischen ist zwar bereits halb zwölf, aber ich muss ja keinen Maraton gewinnen. Ich packe zusammen und bezahle mein Zimmer - CHF 26.- mit Frühstück. Dann bin ich wieder unterwegs.
Auf Anraten einer freundlichen Dame vom Verkehrsverein Jura, vermeide ich Le Noirmont. Stattdessen gehe ich via Muriaux und Emibois nach les Breuleux und von dort via Peuchapa (oder so ähnlich) nach la Ferrière. Es klappt alles verhältnismässig gut. Allerdings gehe ich fast immer auf geteerten Strassen. Also keine romantischen Wege. Das ist zwar etwas Schade, doch die Strassen sind meist klein und haben nur wenig Verkehr, sodass es mir leicht fällt, mit meinem Schicksal zufrieden zu sein.
In Muriaux wies mich ein Strassenarbeiter auf ser praktische Weise auf den rechten Weg. "Ja, da müssen Sie zurück. Bon, hier, nehmen Sie ihren Stock und fühlen Sie hier, dieser Zaun. Bon. Immer hier fühlen und diesem Zaun entlang und Sie kommen nach etwa hundert Metern auf ein Strässchen und einen Durchgang. Das ist Ihr Weg. Immer hier fühlen ...". Er nahm meinen Stock und zeigte mir den Zaun. ich vermute, dass ich damit eine Abkürzung querfeldein gemacht habe, denn als ich schüchtern fragte, ob ich nicht der Strasse entlang zurückgehen könne, sagte er entschieden: Nein nein, folgen Sie diesem Zaun. - Sehr praktisch und unsenntimental.
In les Breuleux diskutierte ich meinen weiteren Weg mit einigen Männern, die im Restaurant neben der Kirche den Nachmittag genossen. Einer von ihnen, Mischu, brachte mich danach an die am Dorfende liegende Abzweigung nach Peuchapa, dem für mich ersonnenen Weg. Während der ca. zehn Minuten dorthin erzählte Mischu, dass er vor einem halben Jahr seine Wohnung aufgegeben habe und jetzt in einem Tippi wohne. Er sei jetzt 50 und habe genug von dem bisherigen geregelten Leben. Er erzählte ein wenig von seinem Sohn und den menschen im Jura: Ja, es sei sehr schön hier, doch menschlich sei das Leben oft sehr eng. Alle kennten sich und man rede praktisch nur immer darüber, was dieser und jener wieder getan oder nicht getan habe. Dabei werde alles kritisiert, was ein wenig vom üblichen abweiche. Eben viel Enge und Missgunst, wenig Fanntasie und Toleranz. Das sei manchmal schwierig.
Auf dem Weg nach Peuchapa habe ich offenbar wieder einmal eine Rechtsabzweigung erwischt, die ich nicht hätte nehmen sollen. Als ich, durch die lange Steigung misstrauisch geworden, einen vorbeifahrenden Forstarbeiter nach dem Weg fragte, schickte er mich ein gutes Stück zurück. Ich wollte zunächst nicht, konnte mir nicht vorstellen, weshalb dies nötig sei, doch hatte er recht. Nach dieser 60minütigen Extratour ging dann alles glatt. Es langweilt mich etwas, dass das Finden und Wiederfinden des Weges in meinem Erleben und in diesem Bericht einen so grossen Raum einnimmt, doch so schnell gewöhnne ich mich offenbar nicht an mein Dasein als blinder Wanderer. Noch ist alles ein Experiment und etwas besonderes, und ich muss über jede verpasste Abzweigung und jeden Umweg buch führen. Tatsächlich ist das, was ich hier tue, ja auch nicht gerade alltäglich.
In Les Bois, wo ich wieder auf die Hauptstrasse kam, empfahl mir ein freundlicher Helfer, unbedingt auf der linken Strassenseite zu gehen. Sie sei sicherer. Ja, nach ein oder zwei Stunden sei ich in La Ferrière. Ich tat wie er sagte und ging und ging und ging. Es schien ewig zu dauern. Die Strassenführung durch Les Bois ist unangenehm. Viele enge Stellen, viel zu schneller Verkehr. Die offene strecke danach war okay, sie schien einfach endlos und wieder, wie immer auf diesen Strassen, keine Menschenseele weit und breit, nur in sechser und zehnerpacks vorbeifahrende Autos.
Als ich schon dachte, la Ferrière kommt nie, rief mich jemand. Es war der mensch von Les Bois. Er sei mir nachgefahren, weil er plötzlich überlegt habe, dass ich, wenn ich auf der linken Strassenseite gehe, Probleme bei dem vor mir liegenden Kreisel bekommen werde. Er habe mich jetzt beobachtet. Ich sei sehr diszipliniert und sicher gegangen, doch es wäre jetzt doch besser, auf die rechte Seite zu wechseln. Das Cheval Blanc sei im übrigen noch etwa drei km entfernt. Er hatte mir schon in Les Bois angeboten, mich nach laa Ferrière zu fahren, doch hatte ich ihm gesagt, dass ich von Basel bis Genf laufen wolle, und dass dieser Plan zerfallen würde, sobald ich damit beginne, Kompromisse zu machen. Das verstand er und liess mich deshalb auch jetzt wiedr ziehen.
Im Cheval Blanc angekommen wurde ich von einem seiner Kollegen begrüsst: Ja doch, Quinon habe angerufen und mein Kommen angekündigt. Wenn sie im Cheval Blanc seien, sollten sie mich doch in Empfang nehmen ... "Sie" das waren Christoph und Terrier, die sich nach der Arbeit öfter für ein Bier im Cheval Blanc treffen, bevor sie heimgehen. Manchmal sei auch Quinon, mein Mann aus Les Bois dabei, aber heute abend sei er offenbar zu müde. Ich wollte mich zuerst vergewissern, dass ich tatsächhlich hier schlafen kann, doch die beiden hielten nichts von solcher Vorsorge. Ich solle essen und trinken. Ein Zimmer werde sich schon finden. Nach zwei Stunden und ein paar weiteren fröhlichen Bekanntschaften ging ich zu Bett.
9. Oktober 2010, 6. Tag
Der Wirt des Cheval Blanc hatte - wie Christoph und Terrier am Abend zuvor - empfohlen via Basmonsieur zur Vue des Alpes zu gehen. Die Instruktionen waren relativ klar und ich zog gegen halb zwölf guten Mutes los. Am Ausgang des Dorfes half mir eine Frau über die Strasse und brachte mich zu dem Weg hinterm riedhof, den ich nehmen sollte. Leider kam sie auf die Idee, mich ein Stück weit zu begleiten. Sie wolle bloss schnell ihre Hunde holen und dem Mann Bescheid sagen. ich solle schon mal losgehen, sie werde mich dann einholen.
Eine sympathische Aktion, spontan und ungewohnt für die organisierte Schweiz. Leider redete die Frau dann während des ganzen Weges zur Vue-des-Alpes. An Themen fehlte es ihr nicht: Ihr Mann, die heutige Jugend, die beste Art ein Ommlett zu machen, die Dummheit der Menschen, ihr Garten, ihre Kinder und Kindeskinder ... Ich wurde immer stiller und wartete sehnsuchtsvoll auf den Moment, wo sie mich wieder mir selber überlassen würde oder keine Puste mehr hätte. Doch sie war zäh mit ihren 72 Jahren. Erst gegen drei Uhr waren wir dort, wo sie umkehren wollte. Jetzt gehe es nur noch der Hauptstrasse entlang. In ca. 2 km sei ich auf der Vue des Alpes. Dort solle ich wieder fragen. Unmittelbar vor der Passhöhe gehe rechts die Strasse zum Tête de Ran ab.
Während ich weiter trottete genoss ich die Ruhe. Nur noch das Wisch Wisch Wamm Wamm der vorbeifahrenden Autos. Kein, "Vous saivez, moi, je suis une persone qui ..." und "mais bon, vous savez comment les gents reagissent ...". nur noch dieses anonyme Wummm, Wisch ... Idyllisch!
Vor der Passhöhe bog ich zum Tête de Ran ab. Gegen vier oder halb fünf war ich bei einem einfachen Restaurant, welches auch "Schlafen im Stroh" anbot. Es ist ein Familienbetrieb mit etwas zusätzlicher Landwirtschaft, ca. 1 km vom vornehmeren Hotel auf dem Gipfel des Tête de Ran entfernt. Erstmals während der ganzen Tage gab's reichlich Ausflügler und andere Wanderer.
Nach einem guten Milchkaffee und anregenden Gesprächen mit ein paar Menschen an meinem Tisch liess ich mir vom Wirt die Scheune mit dem Stroh zeigen und beschloss übernacht zu bleiben. Als ich dabei war, mich einzurichten, bekam ich Besuch von der kleinen Angela Maria, der siebenjährigen Tochter der Wirtsleute. Sie bat mich, aus der Scheune zu kommen. Auf meine Frage, weshalb, sagte sie: Draussen könne sie das Weisse in meinen Augen besser sehen. - Ich war platt! Kinder bringen so was zustande - einfach so ohne Tatü und Tata, ohne "o Sie armer" und all die andern Dinge, mit denen die meisten Erwachsenen belastet sind.
Draussen schaut sie sich das Weisse genau an. Nein, grusig fände sie es nicht, aber so was habe sie noch nie gesehen. Ob es weh tue und weshalb ich überhaupt blind sei und welcheFarben meine Augen denn früher gehabt hätten. Zwei andere Kinder gesellen sich zu uns. Bald sind meine Augen nicht mehr interessant. Angela Maria zeigt unss ihre Hütte. Jetzt beginne ich sie auszufragen. Sie erzählt ein wenig von ihren Geschwistern, alle älter als sie, irgendwo in der Welt zerstreut. Ein richtiges Patch-Work-Family Kind, sehr zutraulich und gesprächig. Für die Eltern ein Problem, weil Angela Maria wirklich keine Grenzen zu kennen scheintt. Sie fragte mich, ob es mich stören würde, wenn sie bei mir im Stroh schlafen würde. Ich sagte nein, doch müsse sie ihre Eltern um Erlaubnis fragen. Die Eltern redeten ihr den Plan glücklicherweise aus, glücklicherweise nicht meinetwegen, sondern ihretwegen. -
Jetzt sitze ich in der einfachen Gaststube und schreibe. Es ist Sonntag Vormittag. Ich ging früh schlafen und will bald weiter in Richtung Mont Racine. Die Wirtsleute, mit denen ich noch ein wenig über Angela Maria und ihre Arbeit auf dem Tête de Ran gesprochen habe (sie sind erst seit ca. 2 Jahren dort) haben mir Instruktionen mit auf den Weg gegeben.
10. Oktober 2010, 7. Tag
Von meinem Nachtquartier aus - ich war übrigens der einzige Gast im Stroh, eigentlich sei die Saison vorüber - kam ich nach ungefähr einer Stunde auf den Chemin des crêtes, vonh dem aus man westwärts weit nach Frankreich hinein und auf der anderen Seite über den Neuenburgersee in die Alpen siehtt. Im tiefland war Nebel, doch dort oben, auf rund 1.400 metern, war strahlende Sonne.
Leider stellte ich bald ffest, dass dieser Weg wieder einer von der Sorte ist, mit der ich kaum zurechtkomme: Zu undeutlich sowohl dort, wo er durch Weiden führt als auch auf den Passagen durch Felsen und Stein. Wenn ich alleine wäre und mich in Ruhe dem Experiment widmen könnte, so würde ich vielleicht versuchen, diesen Weg zu finnden, doch da wie schon am Vortag viele Wanderer unterwegs waren, gab ich es bald auf. Ich fragte einen vorbeispazierenden Mann, ob er mir als "guide sonor" dienen würde. Ich erklärte ihm, dass es für mich sehr aufwendig sei, diese Wege allein, nur mit meinem weissen Stock zu finden, sodass mir sehr geholfen wäre, wenn ich hinter jemandem hergehen könne. Er willigte ein und wir blieben bis jenseitts des Mont Racine - wesentlich länger als ursprünglich vorgesehen - zusammen, da es offensichtlich war, dass ich ohne Hilfe auf dem Weg wirklich nur im Schneckentempo vorankommen würde. Ich entschuldigte mich einige Male, dass er jetzt unfreiwhillig Teil meines Experimentes geworden sei, allein von Basel nach Genf zu laufen, doch er wehrte ab: Er finde das interessant und er lerne dadurch erst noch eine Streckke kennen, die er bisher noch nicht gekannt habe. In Grand-Sangeule oder so ähnlich übergab er mich dann Ruedi und Marcel. Wir hatten mit ihnen über mögliche Weiterwege für mich diskutiert und sie nahmen mich danach bis hinunter nach Pont-Martel mit. Von dort aus gäbe es eine kleine Nebenstrasse nach Bayard, die vermutlich meine beste Wahl sei. Wir tranken noch einen Kaffee und assen jeder ein Corne mit Schlagsane, dann brachen wir auf.
Der Abstieg dauerte wesentlich länger als wir angenommen hatten, denn inzwischen war der Nebel vom Tal hinauf gekrochen und obgleich die zwei die Gegend recht gut kannten kamen wir nicht dort an, wo wir hätten ankommen sollen. Das Ergebnis war eine zusätzliche Stunde Weg auf einer Autostrasse. Wir nutzten die Zeit und redeten viel. Die beiden leben offenbar zusammen. Es war angenehm, so mit ihnen zu gehen und mich nicht mehr um den Weg kümmern zu müssen - angenehm, aber irgendwie auch langweilig und entschieden nicht das, was ich in diesen Tagen lieben und hassen gelernt habe.
Bevor wir uns trennen, zeigen die zwei mir noch einen Platz für mein Zelt am Rande von Pont Martel. Ich müsse morgen nur dem Weg entlang bis zur Strasse. Dann müsse ich nach links, immer weiter bis nach Bayard -, 25 oder 30 km. Nein, es sei eine kleine Strasse mit sehr wenig Verkehr und keine Abzweigungen. Die Sache klang verlockend, und während ich das Zelt aufstellte und in meinen Schlafsack krabbelte, dachte ich dauernd daran, wie ich am nächsten Morgen auf meiner kleinen Strasse ausziehen würde, immer durch Sonne, Felder und Wäldr bis nach Bayard - 30 km ohne Irrungen und Wirrungen irgendwelcher Art!
11. Oktober 2010 8. Tag
Ich stand kurz nach sieben Uhr auf und machte mich nach etwa einer Stunde auf den Weg. Leider war das, was ganz einfach sein sollte, einmal mehr nicht ganz so einfach, wie ich gehofft hatte. Kaum war ich auf der gepriesenen kleinen Strasse verwandelte diese sich auf mysteriöse Weise in einen Parkplatz. dann stand ich vor einem Gebäude, um das ich irgendwie herum musste, bevor ich wieder auf meiner Strasse war. Scheisse, Scheisse, Scheisse.Es hatte doch alles so leicht geklungen!
Ein älterer Herr will mir helfen: Ob ich zur Halle wolle? Nein? Nun, wohin dann? - Ja wohin eigentlich. Der freundliche Helfer nennt Namen von Dörfern und Tälern. Ich verstehe nicht, wovon er spricht. Ich kenne die Gegend nicht und will nur meine Strasse. Nein, keine weiteren Routenvorschläge! Ich bin nicht sehr kommunikativ; habe auch noch keinen rechten Kaffee gehabt. Schliesslich gibt er auf, und ich gehe weiter auf dem, was ich für "meine Strasse" halte und was wohl auch meine Strassse ist.
Allmählich kehrt meine Zuversicht zurück. Wieder ist das Wetter prächtig. Warme Sonne und nur alle fünf Minuten ein Auto. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Doch dann - was ist das? Meine Strasse wird immer kleiner. Ich bin etwas beunruhigt, doch ich gehe weiter bis sie nach weiteren 10 oder 15 Minuten zu einem gewöhnlichen Feldweg wird. Dabei habe ich doch genau das gemacht, was ich laut Ruedi und Marcel tun sollte. Ich will deshalb immer noch nicht umkehren, aber als der Feldweg sich plötzlich in einer grossen Weide verliert, ist es offenkundig. Hier ist wieder einmal etwas schief gegangen. Ich muss umkehren. Umkehren? Aber wo war jetzt mein Weg hingeraten? Ich suche mit meinem Stock links und rechts. Überall nur Gras. Da endlich, nach ein paar Minuten so etwas wie eine Spur. Doch, ich glaube, das ist der Weg, auf dem ich gekommen bin ...
Mittlerweile war meine Laune wieder auf einem Tiefpunkt angekommen. Ich setzte mich an den Wegrand, ass und trank und grübelte. Soll ich aufgeben? Zurück ins Dorf und nach dem Bahnhof fragen? - Die Wegbeschreibung von Ruedi und Marcel klang so einfach und jetzt war alles wieder so verdammt kompliziert und mühsam. Mühsam? War es wirklich mühsam oder machte ich es mühsam durch mein Hadern und dieses andauernde innere Hin und Her. Weshalb genoss ich nicht einfach die Sonne. Ich könnte mich ja ein wenig hinlegen oder meine Flöte auspacken. Dass ich den Weg nach Genf finden will ist eine Sache, aber weshalb dieses Drama, wenn ich mich verirre? Ich tue doch wirklich mein bestes, und dieses Beste ist tatsächlich nicht schlecht! Mann, du siehst nichts. Was erwartest du? Du wolltest es doch wissen, und eigentlich geht das ganze doch viel besser als du gedacht hast! Klar, du machst Umwege, die du mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht machen würdest, wenn du die Wegweiser lesen und die Wanderwege sehen könntest, aber du bist untterwegs und du kommst voran! Geniesse es doch und lass diesen ewigen inneren Kampf. Du hast mindestens die Hälfte der Strecke zurückgelegt. Also sei zufrieden und stolz ...
Ich versuche mich bewusst zu entspannen. Ich merke wie demütigend ich solche Situationen empfinde. Ich mag es nicht, wenn ich so hilflos bin. Es kommt mir vor, wie wenn jemand mit mir spielt, mich bewusst quält; dabei ist es meine Erziehung, die in mir brodelt. Wo lernen wir Männer, dass Hilflosigkeit etwas schönes sein kann, weil sie auch Loslassen bedeutet? Wo lernen wir, uns vertrauensvoll der Welt auszuliefern und die Kontrolle über das, was geschieht abzugeben statt jederzeit alles im Griff zu haben?
Allmählich wirkte meine Therapie. Ich hatte mich mit meinem Schicksal versöhnt und ging friedlich zurück, woher ich gekommen war. Nach etwa 20 Minuten hörte ich ein Auto: Sein Geräusch war wie eine Leuchtspur. Dort musste meine Strasse sein. Noch 50 oder 100 Meter und mein Weg mündete tatsächlich in eine etwas breitere Strasse ein. Hier war ich vor anderthalb Stunden offenbar links abgebogen ohne es zu bemerken. Immer diese in flachem Winkel abgehenden Wege, in die man als blinder Mensch so leicht hineinspaziert ohne es zu bemerken. Nun, egal. Jetzt war alles wieder gut ... Ich war wieder auf "meiner Strasse".
Eine Stunde später traf ich einen Pferdetrainer, der mir sagte, dass ich auf dem Weg zum Mont Travers sei. Von dort gehe es ins Val de Travers hinunter. Zuerst komme das gleichnamige Dorf. Von dort solle ich nach Couvet und dann via ouvon nach St. Croix ... Von Bayard war nicht mehr die Rede, doch das kümmerte mich nicht. Die allgemeine Richtung stimmte, und was der Mann erklärt hatte, klang einleuchtend. Doch wiederum ging irgend etwas schief. Diesmal machte mein gps mich darauf aufmerksam. Wiederum hiess es durchatmen und zwei Kilometer zurückgehen. Kein Drama. So ist das Leben.
Beim Abstieg vom Mont Travers kam ich in den Nebel. Eine Weile ist die Strasse recht eng. Links und rechts kleine Felsen. Eigentlich sehr romantisch, aber das Gehen erforderte plötzlich eine wesentlich höhere Konzentration, denn der stärker werdende Wind und das aufgewirbelte Laub machten es schwierig, die manchmal unerwartet um eine Kurve kommenden Autos rechtzeitig zu hören. Dabei war es im Nebel sofort sehr kalt, und ich dachte mit Widerwillen daran, wie es wäre, wenn zur Kälte noch Nässe käme.
Ich fühle mich plötzlich müde. Ich mag keine weitere Seelengymnastik mehr, genug von diesem ewigen stirb und werde! Ich weiss jetzt, dass ich die Aufgabe lösen kann. In weiteren vier oder sechs Tagen wäre ich in Genf. Auf dem Mont Travers hatte mein gps mir mitgeteilt, dass es rund 200 km zu Fuss bis Basel seien. Ich hatte also eine beträchtliche Strecke hinter mich gebracht, und wenn ich müsste, würde ich auch den Rest und mehr schaffen. Aber muss ich müssen?
In Travers stand mein Entschluss fest. Enough is enough. Es war halb vier Uhr nachmittags.ich war acht Tage unterwegs gewesen, die grösste Wanderung, die ich bis jetzt je unternommen habe. Ich hatte viel prächtige Sonne getankt und mich wieder einmal kräftig bewegt. Meine Schutzengel hatten alles brav mitgemacht, und ich hatte die Sache auch körperlich gut überstanden. Noch zweimal fragte ich: "Pardon, est-ce que vous pouvez me dire ...", und dann wartete ich auf den Zug nach Neuchàtel. Um halb acht abends war ich in Basel.
In den folgenden Wochen habe ich ein paar mal versucht, über diese Wanderung zu schreiben, doch war ich mit meinen Versuchen nie zufrieden. Auch dieser Bericht gefällt mir nicht. Was ich schildere klingt so uninteressant und banal. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das, was an meiner Unternehmung wirklich besonders war, nicht zum Ausdruck bringen kann, und doch ist da etwas - vielleicht das Überschreiten einer unsichtbaren Grenze, an die ich bis jetzt geglaubt, deren Bann ich mit dieser Unternehmung jedoch gebrochen habe. Vielleicht ist es die banale Tatsache, dass ich wieder einmal, ja in gewissem Sinn erstmals zufuss unterwegs war, etwas was noch vor 150 Jahren für alle, die kein Pferd besassen und kein Geld für die Postkutsche hatten, selbstverständlich war. Vielleicht ist es die Tatsache, dass ich seit 30 Jahren nicht mehr unter offenem Himmel geschlafen habe. Ich weiss es nicht. Aber ich weiss, dass ich bereits zwei Tage nach meiner rückkehr nach Basel eine grosse Lust in mir verspürt habe, bald wieder auf eine solche Wanderung zu gehen.
© Martin Näf 2010